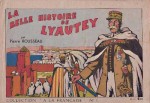dimanche, 29 avril 2007
G. Sorel: Syndikalismus und Faschismus

Der Franzose Georges Sorel (1847 bis 1922) inspirierte Syndikalismus und Faschismus
http://www.deutsche-stimme.de/
Vor 80. Jahren verstarb mit Georges Sorel ein radikaler Kritiker der europäischen Dekadenz, der neben Friedrich Nietzsche als einer der »Erzväter« (Armin Mohler) des großen geistigen Umbruchs vom 19. zum 20. Jahrhundert gelten kann. Der Hasser der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft unterzog den materialistischen und vernunftgläubigen Marxismus einer grundsätzlichen Kritik. An dessen Stelle setzte er den Mythos, die Gewalt, den Heroismus und den Opfergeist. Marxismus und Liberalkapitalismus erkannte er als zwei Richtungen einer blutleeren Aufklärungsideologie.
Georges Sorel gehörte wie Friedrich Nietzsche zu den Denkern des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die eine galoppierende Dekadenz ihrer Zeit feststellten und darauf nicht mit einer Flucht in die gute alte Vergangenheit reagierten. Ihr Ziel konnte nicht mehr die Bewahrung oder gar Wiederherstellung des Überkommen sein – zu schützen galt vielmehr das Wesentliche an sich in einer Synthese aus Reaktion und Revolution. Armin Mohler als Bibliograph der Konservativen Revolution betont »das faszinierende Ineinander eines gigantischen Reaktionärs mit einem begeisterten Aufspürer aller revolutionären Impulse, in denen Sorel ein Gegengift gegen die von ihm so gefürchteten Erstarrungsformen des Politischen (Bürokratie, Bonzokratie, Doktrinarismus, Geldherrschaft) sah.«
Gegen »Demokratie« und Geldherrschaft
Der geistige Werdegang wies Sorel als einen stets mit sich ringenden Denker aus, der vom Altkonservativen zum Marxisten, dann zum Revisionisten und revolutionären Syndikalisten und schließlich zum Quasi-Faschisten wurde. Geistige Klammer aller seiner Denkphasen war die schroffe Ablehnung der bürgerlichen Demokratie. Helmut Berding betont in seinem Buch »Rationalismus und Mythos. Geschichtsauffassung und politische Theorie bei Georges Sorel«:
»Sorel hat die Argumente fast aller ihrer (der bürgerlichen Kultur; Anm. J.W.G.) Gegner aufgenommen und das herrschende liberal-demokratische System seiner Zeit mit den verschiedenen Konservatismen im Namen der Vergangenheit, mit den verschiedenen Sozialismen im Namen der Zukunft und mit den systemimmanenten Kritikern im Namen der Revision bekämpft. Sein Antidemokratismus wird zum Angelpunkt seines gesamten Werkes.« Weiter Berding: »In Übereinstimmung mit den revolutionären Bewegungen von links und rechts hat Sorel die bürgerliche Demokratie verneint.«
Auch in diesem Zusammenhang ist wieder darauf hinzuweisen, daß Liberalismus – der Kern der sogenannten bürgerlich-parlamentarisch-kapitalistischen »Demokratie« – in keinster Weise mit der Demokratie als solcher, nämlich der Volksherrschaft, gleichzusetzen ist! Die Gleichsetzung des volksfeindlichen Liberalismus mit der Demokratie ist verbaler Etikettenschwindel. Auf den Mißbrauch des Demokratiebegriffs reagierte Sorel mit der scharfsinnigen Bemerkung: »Ich bin kein Demokrat; also verachte ich das Volk nicht!« Demokratismus setzte der Franzose also mit Volksverachtung gleich. Das, was die Herrschenden schon zu seiner Zeit als Demokratie ausgaben, war für Sorel bloß die verkleidete Herrschaft des Geldadels. Für die heutige politische Auseinandersetzung noch brauchbar ist seine prägnante Formulierung von der »demagogischen Plutokratie«.
Über sie schrieb er 1889:
»Das Übel einer solchen Regierungsform liegt darin, daß sie nur den Grundsatz des Tausches kennt; die Menschen selbst gelten nichts; nur die Guthaben werden verglichen. So hat die Vorherrschaft des ökonomischen Gedankens nicht nur eine Verdunkelung des Sittengesetzes zur Folge, sondern auch eine Entartung der politischen Grundsätze.«
Sorels ideologische Sprünge und die Verbindung rechter und linker Ideen erschwerten stets eine klare Lager-Zuordnung und trugen ihm den Ruf eines Abweichlers und Sonderlings ein.
Versagen von Marxismus und Arbeiterbewegung
Auf die Jahre zwischen 1893 und 1897 läßt sich die Phase datieren, in der Sorel an der ersten marxistisch ausgerichteten Zeitschrift Frankreichs mitarbeitet und die Lehre Karl Marx’ in seinem Land popularisierte. In einer revolutionären Arbeiterschaft erblickte er das Subjekt, das der bürgerlichen Dekadenz und der Geldherrschaft den Garaus bereiten könne.
Schon bald kam es jedoch zur Abwendung von den marxistischen Arbeiterparteien als Sorel erkennen mußte, daß die Arbeiterführer und ihre Gefolgschaft aufgrund materieller Besserstellung zur Integration in den bürgerlichen Staat bereit waren. Das allgemeine Wahlrecht, der Achtstundentag und die Schulpflicht hatten die Arbeiterklasse korrumpiert und weichgemacht; die Arbeiterklasse befand sich nach dem Befund Sorels auf dem Rückzug, unfähig und unwillig, die liberale Demokratie mitsamt der ihr innewohnenden Dekadenz zu vernichten. Aber auch die marxistische Doktrin selbst hatte nach dieser Lesart versagt: Ihre mit wissenschaftlichem Pathos unterlegten Vorhersagen über den geschichtsnotwendigen Untergang des Kapitalismus hatten sich als unwahr erwiesen. Um die Jahrhundertwende erschien der Kapitalismus durch soziale Zugeständnisse an die Arbeiterschaft und die Aufrichtung einer demokratischen Fassade gefestigter denn je.
Die Einsicht in das Versagen der Arbeiterschaft führte Sorel, nach seiner Zeit des revolutionären Syndikalismus (1902-1909), zur Entdeckung der Nation als einzige denkbare Bezwingerin der Bourgeoisie-Gesellschaft. Vor allem aber brach der in der Normandie geborene Denker mit der dogmatischen Lehre des Juden Marx wegen deren Materialismus, Wissenschaftsgläubigkeit, Unterbewertung des Moralischen und ihrer Volksferne.
Sozialismus statt Marxismus
Am Sozialismus hielt Sorel fest, nur gab er ihm einen idealistischen, mythischen und irrationalistischen, d.h. antimarxistischen, Bedeutungsgehalt. Den Marxismus erklärte er aufgrund der fehlenden Erhabenheit für genauso unsittlich wie den Liberalkapitalismus und die ihn tragende Schicht. Sorel schrieb: »Das Erhabene ist in der Bourgeoisie erstorben; so muß sie fortan jeglicher Ethik entbehren.« Sorels Auffassung vom Sozialismus war stark von ethischen Überlegungen geprägt. Er definierte: »Alles in allem ist der Sozialismus eine Metaphysik der Sittlichkeit.« Sozialismus war hier nicht wie im Marxismus eine Frage von Lohnsteigerungen, materiellem Glück und Menschheitsverbrüderung, sondern von einem kampferfüllten Leben, von Ehre, Heldentum, Seelenadel und der Urgewalt des Mythos.
Syndikalismus, Gewalt und Generalstreik
Bevor Sorel im revolutionären Volk in der politischen Gestalt der Nation den Träger einer antibürgerlichen Erhebung sah, setzte er seine Hoffnungen noch einmal auf die Arbeiterschaft im Verbund mit der Macht der Gewerkschaften. Kern des Denkens und Hoffens wurde der Generalstreik, der einen mythischen Gehalt bekam. Inspiriert von Sorels Ideen des Mythos und der Gewalt – angereichert mit anarchistischen Vorstellungen – organisierte sich in dem romanischen Ländern um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die Arbeiterschaft immer stärker in Gewerkschaften (franz. syndicat). Die »direkte Aktion« in Form des Generalstreiks, der Sabotage oder der Fabrikbesetzung fußte maßgeblich auf Sorels Vorstellungen der heroischen Gewalt. In den »Betrachtungen über die Gewalt« (1908) stellte er die Gewalt als Mittel der Ethik dar, die von politischen Soldaten verkörpert werde, die ihr Leben im Dienst der Gemeinschaft hingeben. Mit Blick auf die syndikalistisch organisierten Arbeiter im Generalstreik stellte Sorel fest:
»Begegnen wir den Revolutionären mit dem Respekt, den die Griechen den spartanischen Helden entgegenbrachten, welche die Thermopylen verteidigten und damit dazu beitrugen, der antiken Welt das Licht zu erhalten.«
Nation statt Proletariat
Sorels glühende Flamme für den Syndikalismus erlosch aber in dem Moment, in dem er erkennen mußte, daß der Proletarier genauso genußsüchtig, materialistisch und fortschrittsgläubig wie der Bourgeois ist: »Der Utilitarismus nagt an der Bourgeoisie genauso wie am Volk.« Hinzu kam, daß der revolutionäre Syndikalismus nach dem frühen Tod seines treibenden Aktivisten, Pelloutier, zunehmend zu »Politik« erstarrte, was Sorel ja gerade hatte vermeiden wollen. Nun näherte er sich der Erneuerungsbewegung der französischen Rechten, der »Action francaise«, an und nimmt darüber hinaus Kontakt zu Personen auf, deren Anliegen die Zusammenführung von gleichermaßem revolutionärem Nationalismus und Sozialismus ist. Charles Maurras als Ideengeber des neuen Nationalismus formulierte:
»Ein von demokratischen und kosmopolitischen Elementen befreiter Sozialismus kann sich dem Nationalismus wie ein gut gemachter Handschuh einer schönen Hand anpassen.«
Der Maurras-Gefolgsmann Georges Valois erklärte im Dezember 1911:
»Es war kein Zufall, daß unsere Freunde den Aktivisten des Syndikalismus begegnet sind. Die nationalistische und die syndikalistische Bewegung, so fremd sie in ihren heutigen Standpunkten und Tendenzen einander erscheinen mögen, haben mehr als ein gemeinsames Ziel.«
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, daß es erst recht unter dem Eindruck der nationalen Kriegsbegeisterung und dem gefeierten Kult von Heroismus, Gewalt und Vitalismus zur geistigen Verschmelzung von Syndikalismus und Nationalismus, von Nationalsyndikalismus und Linksnationalismus kam. Allerspätestens seit dem Kriegsausbruch 1914 waren viele linke Querdenker und Empörer von der revolutionären Durchschlagskraft des Nationalismus überzeugt und trennten sich von den Restbeständen proletarisch-internationalistischen Denkens.
Der jüdische Politikwissenschaftler Zeev Sternhell schreibt in seiner Arbeit »Die Entstehung der faschistischen Ideologie - Von Sorel zu Mussolini« zum Subjektwechsel vom Proletariat zur Nation: »Das versagende Proletariat sollte durch jene aufstrebende Macht der modernen Welt ersetzt werden, die aus dem Fortschritt, den Unabhängigkeitskriegen und der kulturellen Integration geboren worden war: durch die Nation. Alle ihre Klassen sollten zusammengeschweißt werden im gemeinsamen Kampf gegen die bürgerliche, demokratische Dekadenz.«
Der geschichtstreibende Mythos
Durch den Austausch des Revolutionsträgers, des Proletariats durch die Nation, und die Entdeckung der politischen Macht des Mythos war Sorel einer der großen Inspiratoren gerade auch des italienischen Faschismus unter Benito Mussolini. Darüberhinaus prägte er die Geschichtsphilosophie vieler großer Geister, so auch des Staatsrechtlers Carl Schmitt, der feststellte:
»In der Kraft zum Mythus liegt das Kriterium dafür, ob ein Volk oder eine andere soziale Gruppe eine historische Mission hat und sein historischer Moment gekommen ist. Aus der Tiefe echter Lebensinstinkte, nicht aus einem Räsonnement oder einer Zweckmäßigkeitserwägung, entspringen der große Enthusiasmus, die große moralische Dezision und der große Mythus. In unmittelbarer Intuition schafft eine begeisterte Masse das mythische Bild, das ihre Energie vorwärtstreibt und ihr die Kraft zum Martyrium wie den Mut zur Gewaltanwendung gibt. Nur so wird ein Volk oder eine Klasse zum Motor der Weltgeschichte. Wo das fehlt, läßt sich keine soziale und politische Macht mehr halten, und kein mechanischer Apparat kann einen Damm bilden, wenn ein neuer Strom geschichtlichen Lebens losbricht. Demnach kommt alles darauf an, wo heute diese Fähigkeit zum Mythus und diese vitale Kraft wirklich lebt. Bei der modernen Bourgeoisie, dieser in Angst um Geld und Besitz verkommenen, durch Skeptizismus, Relativismus und Parlamentarismus moralisch zerrütteten Gesellschaftsschicht, ist sie gewiß nicht zu finden.«
Der 1917 gefallene Philosoph und Zeitkritiker Thomas E. Hulme – Lehrmeister vieler mit dem Faschismus sympathisierender literarischer Avantgardisten – würdigte Sorel und seine geistesgeschichtliche Rolle:
»Ein antidemokratischer Revolutionär, ein Absolutist in der Ethik, der jeden Rationalismus und jeden Relativismus verdammt, der das mythische Element in der Religion betont, von dem er weiß, daß es &Mac221;nie verschwinden wird&Mac220;, der mit Verachtung über den Modernismus und den Fortschritt spricht und einen Begriff wie Ehre völlig überzeugend verwendet.«
Jürgen W. Gansel
06:10 Publié dans Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le pouce et la souris
Pascal LARDELLIER
LE POUCE ET LA SOURIS, Enquête sur la culture numérique des ados
Fayard, Paris
Les Technologies d’Information et de Communication (TIC) sont à l’origine d’une
véritable révolution. Depuis quelques années, l’essor d’Internet et de la
téléphonie mobile, entre autres, donne de nouveaux contours à nos relations,
tout en reconfigurant nos vies.
Mais nous ne sommes pas tous égaux devant les TIC. Si les adultes entretiennent
avec elles un rapport essentiellement fonctionnel, il n’en va de même des
adolescents de 2006. Ayant grandi un portable dans une main, une souris dans
l’autre, ces jeunes sont en train d’inventer une nouvelle culture numérique,
dont les codes leur sont spécifiques.
Derrière leurs écrans et grâce à leurs claviers magiques, ils se jouent des
identités, des savoirs, de l’orthographe et des autres. La jungle technologique
est devenu leur terrain de jeu favori. Les ados y passent un temps infini, ce
qui inquiète les parents et interroge la société.
Le Pouce et la souris propose une plongée dans la culture numérique des ados. Il
est issu d’une année d’enquête sociologique (questionnaires, entretiens,
débats…) avec cent trente ados et jeunes étudiants et leurs parents.
Les différents chapitres de ce livre sont consacrés à MSN, à Google, aux blogs,
au téléchargement, aux jeux en réseau ou encore au " parler SMS ". Cet ouvrage
donne des clés pour mieux comprendre le rapport si naturel liant nos ados aux
TIC.
Des pages sont aussi consacrées à la très ambiguë idéologie de la communication
dans laquelle baignent ces jeunes, et aux dangers de la " cyber-addiction ".
Il s’agit d’éclairer les parents et les enseignants, pour leur permettre
d’accompagner cette révolution culturelle, familiale et sociale ; tout en
répondant à cette question cruciale : pourquoi les ados de 2006 se sont-ils
appropriés les " nouvelles machines à communiquer " avec autant de ferveur et
de frénésie ?
A plus vaste échelle, une réflexion est proposée sur la crise de la culture dite
classique (et notamment les pratiques de lecture), et les métamorphoses que
connaissent les relations à l’ère des réseaux.
Pascal LARDELLIER est Professeur à l’Université de Bourgogne (IUT de Dijon) et
chercheur au LIMSIC. Il a publié Le cœur Net. Célibat et amours sur le Web
(Belin, 2004) et Les Nouveaux rites Du mariage gay aux Oscars (Belin, 2005).
| | ||
|
| Résumé : "Le pouce et la souris": Depuis quelques années, l'essor des Technologies d'Information et de Communication (TIC) - Internet et la téléphonie mobile, entre autres - est en train de reconfigurer nos vies. Mais nous ne sommes pas tous égaux devant les TIC. Si les adultes entretiennent avec elles un rapport essentiellement fonctionnel, il n'en va pas de même des adolescents de 2006. Ayant grandi un portable dans une main, une souris dans l'autre, ces jeunes sont en train d'inventer une nouvelle culture numérique, dont les codes leur sont spécifiques. Derrière leurs écrans et grâce à leurs claviers magiques, ils se jouent des identités, des savoirs, de l'orthographe et des autres. La jungle technologique est devenue leur terrain de jeu favori. Les ados y passent un temps infini, ce qui inquiète à bon droit les parents. Il s'agit ici d'éclairer parents et enseignants, pour leur permettre d'accompagner cette révolution culturelle, familiale et sociale : pourquoi les ados de 2006 se sont-ils appropriés les " nouvelles machines à communiquer " avec autant de ferveur et de frénésie? Qu'en est-il de l'idéologie de la communication ambiguë dans laquelle baignent ces jeunes, et des dangers de la " cyber-addiction " ? Enfin peut-on vraiment parler d'une crise de la culture dite classique, et de la métamorphose, des relations à l'ère des réseaux ? Le pouce et la souris propose une plongée dans la culture numérique - MSN, Google, blogs, téléchargement, jeux en réseau ou encorer " parler SMS " -, tout en donnant des clés inestimables pour mieux comprendre le rapport si nature liant les adolescents aux TIC. | |
06:05 Publié dans Ecole/Education, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 avril 2007
Sur Jean Eugène van der Taelen
Sur Jean Eugène van der Taelen
Article de "Wikipedia" : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Eug%C3%A8ne_van_der_Tae...
Article d'ALTERMEDIA-Belgique : http://be.altermedia.info/communiqu/hommage-a-jean-eugene...
06:15 Publié dans Biographie, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
G. Sorel et la naissance du mythe moderne
Ecole des cadres / Lectures conseillées:
 GIANINAZZI Willy |
| ISBN 2-7315-1105-9 24 € |
Présentation
Qu'est-ce le Mythe ? Les réponses ont toujours été partielles et insatisfaisantes. Car le mythe est une notion privée de sens univoque et intemporel : elle ne s'éclaire que par sa mise en histoire.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le mythe, entendu comme fabulation et erreur, a été une construction scientifique qui a servi à stigmatiser les croyances. La philologie et l'anthropologie, relayées par l'hellénisme, en ont été les sciences mères. Mais, avec la crise qui ébranla la raison scientifique au tournant du siècle, une brèche s'est ouverte en faveur d'un renversement des valeurs : le Mythe attendait une réévaluation. Ce livre explore le contexte et les enjeux de cet avènement méconnu.
En étudiant la société de son temps, Georges Sorel s'est fait à la fois le censeur et le promoteur du mythe moderne. Nourri de ses lectures de Platon, Vico, Marx et Renan, il engagea le dialogue avec ses contemporains, Bergson, Ribot, Le Bon et Durkheim.
En préférant le mythe à l’utopie, la pensée déroutante, mais toujours stimulante et actuelle de Sorel,.invite à une substitution de concepts et de contenus, dense de significations et de potentialités pour un réenchantement du politique et pour une régénération de la démocratie.
Willy Gianinazzi est historien et membre de la rédaction de Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle. Il est l'auteur d'ouvrages sur le syndicalisme révolutionnaire en Italie.
Sommaire
I. HISTOIRE ET MYTHE NARRE :
1. Georges Sorel, historien méconnu — 2. Genèse de la morale et survivances du passé — 3. Détour biographique : Un héritage bourgeois et catholique— Un transfuge — 4. La méthode historienne : Une psychologie — Empathie et histoire religieuse — 5. La topographie sorélienne du savoir : Concordat de l’esprit et raisonnements antinomiques — Sciences de la nature, sciences de l’esprit — Vico, au risque du mythe — Apport à la critique marxiste de l’idéologie — 6. Mythes, utopies et violence : Les fictions idéologiques — Prémices d’une théorie de l’action — Mythe versus utopie — Violence versus force — 7. Manipulation et manœuvrabilité des masses : Applicabilité du mythe — II. MOUVEMENT SOCIAL ET MYTHE VECU : 8. Mythe narré, mythe vécu et autonomie ouvrière : La béance du langage — Le mythe nouveau — Esprit plébéien et radicalité ouvrière — Mythe, dogme et retour — 9. Le contexte du mythe : Mythe et évolutionnisme — Intellectuels et critique sociale —L’altérité en procès (anthropologie, durkheimisme, folklorisme, psychologie collective et psychiatrie) — Le paradigme grec — 10. Le retour du mythe : Des hérauts du mythe : Émile Bréhier, Henri Bergson, Victor Brochard — Démythisation, démythologisation — 11. Ambivalence du mythe : Mythes platoniciens — Mythes historiques et vécus — 12. Improbables influences et affinités certaines. Sorel face à Bergson et Nietzsche : Le cas Bergson encore — Le cas Nietzsche — 13. Métaphysique du mythe et de la liberté : Histoire et pessimisme — Le sublime — Réenchantement moral et spirituel — De la souffrance et du travail — 14. Histoire maîtrisée et mythe régénérateur : Grandeur et décadence — Mythe au présent et rite — Pour conclure : la liberté et la raison — Chronologie sommaire — Orientation bibliographique — Index des catégories et concepts clés Index des noms propres
06:15 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
J. Freund, penseur "machiavélien" de la politique
| Julien Freund. Penseur "machiavélien" de la politique | |
 | Prix : €27,00 En 1993, disparaissait Julien Freund. Onze ans après, en dehors de son ouvrage incontournable L'essence du politique, son oeuvre demeure méconnue en France, en dépit de sa grande richesse. Ce premier livre en langue française consacré à Julien Freund vient donc combler une lacune. Il peut être lu comme une introduction à la pensée de cet ancien résistant atypique, à la fois philosophe, politologue et sociologue. Tout en dévoilant la philosophie conflictuelle de Freund, l'auteur montre l'actualité des sujets qu'il a abordés : éthique et politique, souveraineté et mondialisme, idéalisme et réalisme, utopie et violence, autorité et obéissance. L'ouvrage fait dialoguer la pensée de Freund avec les grands penseurs qui l'ont inspirée, d'Aristote à Aron, en passant par Pareto, Weber ou Schmitt, et la situe dans le contexte intellectuel de son époque. Il explique dans quelle mesure le style théorique de Freund ainsi que son approche réaliste du politique permettent de le situer dans la lignée des auteurs dits machiavéliens.
|
06:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 avril 2007
Isidore de Kiev

27 avril 1463 : Mort à Rome d'Isidore de Kiev, qui fut patriarche grec-orthodoxe en Russie, puis cardinal à Rome. Il a tenté de réunir les églises chrétiennes de l'Est et de l'Ouest devant la menace turque. L'Empereur byzantin Jean VIII Paléologue l'envoie en 1434 au Concile de Bâle, pour parfaire la réunification des églises. Byzance le nomme Patriarche de Kiev et de toutes les Russies. Après de nombreux avatars, il rédige, avec le Cardinal grec Jean Bessarion, le document de l'unification, proclamée le 5 juillet 1439, ce qui lui permet de devenir en même temps “Cardinal de Ruthénie” (= Ukraine). Kiev est donc “unie”, mais Moscou refuse la teneur du document d'unification. Le Pape Nicolas V le renvoie à Constantinople en 1452. Il participe activement à la défense de la ville contre les Turcs; au cours du siège, il annonce aux Byzantins l'unification des deux églises au cours d'un prêche dans Sainte-Sophie, ce qui sied à la Cour et à la hiérarchie mais non au peuple, qui continue à proclamer sa haine de la papauté romaine. Isidore de Kiev et ses hommes prennent alors les armes et montent au créneau pour défendre la ville. Isidore y sera blessé, mais parviendra à fuir, vers la Crète d'abord, avant de rentrer à Rome en 1454, où il rédige un récit poignant de la chute de Constantinople, Epistula lugubris. Le Pape Pie II le nomme, à titre honorifique, “Patriarche Grec de Constantinople”.
(illustration : Constantin Paléologue).
06:30 Publié dans Biographie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Sortons de l'Etat-Nounou !
SORTONS DE L'ÉTAT NOUNOU!
par Mathieu Laine
La France est-elle devenue une Grande Nurserie? Obésité, alcool, cigarette, grippe aviaire, vidéosurveillance, CPE, logement, retour du protectionnisme économique, discrimination positive: sur tous les sujets, l’État nounou nous borde et nous protège. Il nous promet un monde propre, sans risque, tolérant et solidaire et ne cesse de nous donner la conduite à tenir.
Dans notre pays, on croit en effet un peut trop que l’État peut tout. Souvenons-nous de nos propres réactions au coeur de la canicule, et écoutons ce que l’on dit aujourd’hui du virus du chikungunya: « Que fait le gouvernement? ». Idem sur le terrain économique: des entreprises étrangères osent s’intéresser à nos plus beaux fleurons, le plombier polonais ou le patron italien font peur? « Allo État bobo! » Courrons vite sous les jupes de Big Mother réclamer de belles lignes Maginot derrière lesquelles nous protéger. Bercés par l’illusion de l’État sauveur, nous sommes bel et bien entrés dans une spirale de la peur et de la défiance aux risques, alimentant le désir d’État et l’infantilisation des Français.
SUITE : http://www.quebecoislibre.org/06/060326-2.htm...
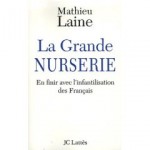
06:05 Publié dans Politique, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
E. Jüngers nationalistische Publizistik

Ernst Jüngers nationalistische Publizistik liegt nun erstmals in einem noblen Sammelband vor
http://www.deutsche-stimme.de/
Nicht alle der konservativen oder liberalen Ernst Jünger-Verehrer werden es wissen oder überhaupt wissen wollen: Aber der größte deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts war in der Zeit der Weimarer Republik, also vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Machtergreifung, »Nationalrevolutionär«.
Was darf man sich nun unter einem Nationalrevolutionär vorstellen? Sicherlich nicht einen Skinhead mit Handgranate oder die europäische Variante eines Dritte-Welt-Guerilleros. Nein, nationalrevolutionäres Denken lag und liegt quer zur herkömmlichen politischen Kategorienbildung von »rechts« und »links« und ist konservativ nur im Hinblick auf seinen höchsten Wert: die Nation, die es gegen alle Gefährdungen zu verteidigen und zu erhalten gilt.
Ernst Jünger (1895 bis 1998) könnte man als den exemplarischen Typus des Nationalrevolutionärs der Zwischenkriegszeit betrachten: In einem langen Aufsatz appellierte er seinerzeit an die ständige »totale Mobilmachung« des Volkes, die Bereitschaft zur Rebellion, die Verachtung der liberalistischen Vorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft und der damals auch bei Teilen der Linken vorhandenen Sehnsucht nach Befreiung der deutschen Nation von der Plage der bürgerlichen Gesellschaft. In einer editorischen Großtat hat nun der Verlag Klett-Cotta die gesamte zwischen Ende 1919 und 1933 entstandene politische Publizistik Ernst Jüngers zu einer beinahe 900 Seiten umfassenden kommentierten Ausgabe zusammengefaßt. Die meisten der hier zusammengefaßten Aufsätze erschienen in nationalistischen Theorieorganen mit meist geringer Auflage, denen sich Jünger manchmal auch als Herausgeber zur Verfügung stellte, wie der »Standarte«, dem »Stahlhelm«, dem »Arminius«, dem »Vormarsch«, den »Kommenden« und dem »Widerstand«. Jüngers publizistisches Engagement für die letztgenannte Zeitschrift verdient besondere Beachtung, denn schließlich war der »Widerstand« das wichtigste Organ der sich um den »Über-Preußen« Ernst Niekisch formierenden »Nationalbolschewisten«. Diese Linksnationalisten forderten zur Abschüttelung des Versailler Diktates ein Bündnis mit der aus der Oktoberrevolution hervorgegangenen Sowjetunion, weil sie der Ansicht waren, »daß ihre Löffel lang genug wären, um auch noch mit dem Teufel vom selben Tisch zu essen« (Karl-Heinz Weißmann).
Ernst Jünger war als vielfach verwundeter Frontoffizier gegen Ende des Ersten Weltkriegs mit dem höchsten Tapferkeitsorden des Kaiserreichs, dem »Pour le Merite«, ausgezeichnet worden und stieg rasch zu einer nationalen Widerstandsfigur im besiegten und teilweise besetzten Deutschland auf. Gerade seine früheren Aufsätze sind noch ganz von den Erschütterungen des Fronterlebnisses durchdrungen: »Der Krieg ist unser Vater, er hat uns gezeugt im glühenden Schoße der Kampfgräben als ein neues Geschlecht, und wir erkennen mit Stolz unsere Herkunft an.«
Ablehnung der morschen bürgerlichen Ordnung
Schnell kam Jünger für sich zu dem Ergebnis, daß die Kriegsniederlage das mit innerer Notwendigkeit eingetretene Resultat der zu Friedenszeiten schon morschen bürgerlichen Ordnung des Wilhelminismus war. Dem ungeheuren Opfer der Millionen an der Front für ihr Land Gefallenen konnte nach Jünger nachträglich nur ein Sinn gegeben werden, wenn die seiner Ansicht nach bruchlose Konstanz einer sowohl vom Kaiserreich als auch der Weimarer Republik repräsentierten bürgerlichen, liberalen und rationalistischen Ordnung durch eine neue Ordnung ersetzt werde, die wieder Zugang zu den tieferen Quellen des Lebens habe: dem Nationalismus. Eine beinahe schon klassische Definition des Nationalismus lieferte Jünger in seinem Aufsatz »Das Sonderrecht des Nationalismus«:
»Wir Nationalisten glauben an keine allgemeinen Wahrheiten. Wir glauben an keine allgemeine Moral. Wir glauben an keine Menschheit als an ein Kollektivwesen mit zentralem Gewissen und einheitlichem Recht. Wir glauben vielmehr an ein schärfstes Bedingtsein von Wahrheit, Recht und Moral durch Zeit, Raum und Blut. Wir glauben an den Wert des Besonderen.«
Interessanterweise sprach Jünger später in seinen Alterstagebüchern »Siebzig verweht« davon, daß er in Deutschland die Begriffe »Nationalismus« und »Nationalisten« mehr oder weniger erfunden habe, um das Unbedingte seiner Position zum Ausdruck zu bringen. Träger der neuen Ordnung sollte nach Jünger der Frontsoldat sein, der schon in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs das höchste Maß an Opferbereitschaft gezeigt hatte und der durch das Kriegserlebnis der alten bürgerlichen Welt entrissen und zu einem neuen »Typus« gebildet worden war:
»Was dort im Lärm der Schlachten unter der Oberfläche eines scheinbar sinnlosen Geschehens an neuen Kräften geboren wurde und weiter wirkend in unsere Zeit hineingreift, jener innere Gewinn, der nicht zu leugnen ist, obwohl wir den Krieg verloren, und der für uns vielleicht wichtiger als jede äußere Ausdehnung ist, muß dem Volke auf Dauer erhalten bleiben. Dem Frontsoldaten, der das äußere Erlebnis in seiner vollen Wucht empfing, liegt es ob, auch die inneren Schlüsse zu ziehen, das große Schicksal, dem er sich gewachsen zeigte, zu einer Quelle der Kraft zu gestalten, und diese Kraft auf die ihm Folgenden zu übertragen.«. Jüngers Beobachtungen an der Front lassen sich vielleicht am besten in die Worte des sozialdemokratischen Arbeiterdichters Karl Bröger fassen, der 1914 dichtete:
»Immer schon haben wir eine Liebe zu Dir gekannt / bloß wir haben sie nie bei ihrem Namen genannt / Herrlich zeigte es aber Deine größte Gefahr / Daß Dein ärmster Sohn auch Dein Getreuester war / Denk es, O Deutschland«.
Überwindung des Klassendenkens
Der Nationalismus sollte nach Jüngers Ansicht das Klassendenken von Kaiserreich und Republik überwinden und sich die legitimen Forderungen der Arbeiterbewegung zu eigen machen: »Und, Kameraden aus der Arbeiterschaft, laßt Euch nicht verblüffen durch jene, die Euch einreden wollen, daß der Nationalismus unserer Zeit gegen Euch gerichtet sei. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der dynastische Staat wurde abgelöst und untergraben durch den Klassenstaat, aber der Klassenstaat wird vernichtet werden durch den nationalistischen Staat. Dessen Fragestellungen gehen quer hindurch durch Marxismus und Kapitalismus, durch die Revolution von 1918 und die Reaktion«.
Jünger definiert die Grundelemente des nationalistischen Staates in mehreren Aufsätzen als national, sozial, wehrhaft und autoritativ, ohne jedoch seine Staatsvorstellung weiter zu präzisieren und beispielsweise zu einem Verfassungsentwurf zusammenzufassen. Und noch etwas wird aus Jüngers politischen Aufsätzen der Weimarer Republik deutlich: Der angeblich in ihnen zum Ausdruck kommende »Antisemitismus«, der den Herausgeber des Spiegel Rudolf Augstein in einem Artikel zum hundertsten Geburtstag Jüngers 1995 noch dazu veranlaßte kundzutun, daß Jünger nie ein Klassiker der deutschen Literatur werden könne, existiert so gut wie gar nicht. Scheitern von Jüngers realpolitischen Ansätzen Jüngers Kultus der Reinheit, der vielleicht zum Scheitern seiner realpolitischen Ansätze beitrug, ließ sich mit haßdurchtränkten Feindbildern nie vereinbaren, und in mehreren Aufsätzen warnt Jünger ausdrücklich davor, in Bezug auf die Juden platten Schwarz-Weiß-Kategorisierungen aufzusitzen. Jüngers wachsende Distanz zur NSDAP kommt schon im Titel des 1927 verfaßten Aufsatzes »Nationalismus und Nationalsozialismus« zum Ausdruck, in dem er den Nationalisten die Aufgabe zuweist, die Idee »möglichst tief und rein zu erfassen«, während der »Nationalsozialismus in seiner Eigenschaft als politische Organisation auf die Gewinnnung von tatsächlichen Machtmitteln angewiesen ist«.
Ein besonderes Schmankerl stellen die vielen Buchbesprechungen Jüngers aus den zwanziger Jahren dar, die auch einen guten Eindruck der damaligen Zeitatmosphäre vermitteln. Unter den besprochenen Autoren finden sich solche Namen wie Alfred Kubin, Edwin Erich Dwinger, Arnolt Bronnen, Franz Schauwecker oder Leo Trotzki. Mit der Veröffentlichung von Jüngers Zwischenkriegspublizistik schließt sich die letzte große Lücke in der Edition seines Werkes. Jünger hatte es abgelehnt, sie in seine »Gesammelten Werke« aufzunehmen, worüber es zu einem schweren Zerwürfnis mit Armin Mohler, seinem Sekretär aus den fünfziger Jahren und selbst einer der wichtigsten Köpfe der Nachkriegsrechten, kam. In den Aufsätzen wird man alles finden, was auch das dichterische Werk Jüngers so unverwechselbar macht: Die Verbindung von analytischer Kühle und stilistischer Sicherheit mit einer immer spürbaren Leidenschaft für das von ihm behandelte Thema. Seine »Politische Publizistik« dürfte den schon von der Germanistik kanonisierten Werken wie »Auf den Marmorklippen« und »Das abenteuerliche Herz« als heimliches Hauptwerk zur Seite treten.
Arne Schimmer
Ernst Jünger: Politische Publizistik. 1919–1933. Klett-Cotta Verlag, 850 S., geb., d 50,00. Zu beziehen über: DS-Buchdienst, Postfach 100068, 01571 Riesa
06:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Geopolitics of Australian Independance

December 3 2006
06:00 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
J. Freund : un philosophe contre l'angélisme
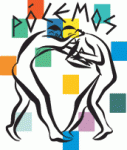 L'œuvre controversée de Julien Freund éclaire la tendance de nos sociétés à la dépolitisation | |
Un philosophe contre l'angélisme
PAR CHANTAL DELSOL *
[Le Figaro, 19 février 2004]
http://www.ac-versailles.fr/PEDAGOGI/SES/reserve/sciences-po-sp/freund_delsol.html
06:00 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 avril 2007
Nouveau drapeau américain

06:20 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les chemins de la puissance
| Les Chemins de la puissance | |
 | Prix : €19,90 Avec la fin de la guerre froide, la notion de puissance disparaissait progressivement du vocabulaire courant des démocraties. L'ère de la mondialisation devait sceller l'apogée des Etats-Unis après trois victoires historiques majeures. L'Amérique s'est substituée aux empires coloniaux dans le nouvel ordre mondial. Elle a triomphé militairement des puissances de l'Axe et elle a grandement contribué à l'effondrement du bloc soviétique. Sans adversaire, la superpuissance américaine avait le champ libre pour imposer son modèle de développement et de démocratie au reste du monde. La guerre civile irakienne a remis en cause cette fin de l'Histoire. En échouant en Irak, l'armée américaine ouvre la voie à une nouvelle ère dans les relations internationales. La Russie, la Chine, l'Iran exploitent la brèche et revendiquent une nouvelle place dans les relations internationales. D'autres pays sont en embuscade pour se faufiler sur ces nouveaux chemins de la puissance. Il est temps de reconsidérer notre approche du monde. Le XXIèsiècle sera dominé par la problématique de l'accroissement de puissance. Chaque recul des Etats-Unis sera une avancée d'un pays conquérant dans la géopolitique, l'économie ou la culture. Ont participé à cet ouvrage : Philippe Baumard, Eric Delbecque, Pierre-Marie Fayard, Philippe Forget, Patrice Fribourg, Christian Harbulot, Didier Lucas, Nicolas Moinet.
|
06:10 Publié dans Défense, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Lyautey, le "Marocain"
06:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
R. Guénon o la madre de todas las confusiones
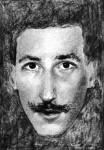
Ernesto MILA :
René Guénon o la madre de todas las confusiones
http://infokrisis.blogia.com/2005/022401-rene-guenon-o-la-madre-de-todas-las-confusiones.php
06:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 25 avril 2007
Mort programmée de l'école
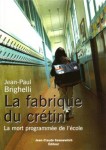
La fabrique du crétin
La mort programmée de l'école
16,90 euros
Nos enfants ne savent plus lire, ni compter, ni penser. Le constat est terrible, et ses causes moins obscures qu'on ne veut bien le dire. Un enchaînement de bonnes intentions mal maîtrisées et de calculs intéressés a délité en une trentaine d'années ce qui fut l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Faut-il incriminer les politiques, les profs, les parents, les syndicats, les programmes ? En tout cas, la Nouvelle Pédagogie a fait ses « preuves » : l'école a cessé d'être le moteur d'un ascenseur social défaillant. Ceux qui sont nés dans la rue, désormais, y restent. Dès lors, que faire ?
Jean-Paul Brighelli analyse avec une lucidité féroce, sans nostalgie exagérée, cette école de la réussite devenue si souvent école de l'échec programmé et donne des solutions pour une école de demain. Normalien, agrégé de Lettres, il a, du collège à l'université, parcouru l'essentiel du paysage éducatif. Longtemps impliqué dans l'édition scolaire et para-scolaire, il en démonte au passage les mécanismes et les intérêts convergents.
ENTRETIEN AVEC JEAN-PAUL BRIGHELLI : http://www.sauv.net/brigh4verites.php
06:15 Publié dans Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Affiche Ezra Pound
06:10 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Qui suis-je? Fiodor Ungern-Sternberg!
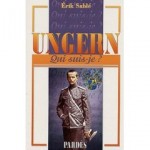
Erik Sablé
Qui suis-je? Fiodor Ungern-Sternberg
Éditeur : Pardès
Pages : 128
Collection : Qui suis-je ?
I.S.B.N. : 2867143829
06:10 Publié dans Biographie, Eurasisme, Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Culture of War in China
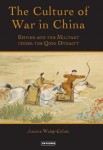
International Library of War Studies v. 7
The Culture of War in China
AUTHOR: Joanna Waley-Cohen
What particularly distinguished the Qing from other ruling houses in China's imperial period? In this pathbreaking book, Joanna Waley-Cohen overturns conventional wisdom to identify military power and an accompanying martial ethos as defining characteristics of the high Qing empire. From 1636 to 1800, Emperors reinforced massive military expansion with a wideranging cultural campaign intended to bring military success, and the martial values associated with it, into the mainstream of cultural life. Military prowess and imperial power were linked in the popular imagination though endless repetition in literature, art and architecture a startlingly modern use of words and images that demonstrates the imperial grasp of culture's potency as a political tool. Overturning the presumption that reads back China's late-nineteenth-century military weakness into the past, Waley-Cohen shows that the Qing strongly emphasized military affairs, which they understood as complementary rather than subordinate to civil matters. Arguing that the militarization of culture that took place under the high-Qing emperors provided fertile ground from which the modern militarized nation-state could develop, Waley-Cohen contends that the past two centuries of Chinese weakness on the international scene may turn out to have been a protracted aberration, rather than the normal state of affairs. "The Culture of War in China" is a striking revisionist history that brings new insight into the nature of the Qing dynasty and the roots of the militarized modern state.
PUBLISHER: I. B. Tauris, London
PRICE: £47.50
COVER:Hardback
ISBN: 9781845111595
PUBLICATION DATE: 26 May 2006
06:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 24 avril 2007
Een reactie (zomer 2003)

Hoe met de vijand te handelen....
Vanuit de forumredactie: De heer Steuckers vroeg ons om de onderstaande reactie, als rechtzetting op de topic van thePiano, te plaatsen.
groetjes,
Maarten
Uw bericht en "debat" over de meeting in
Lille/Santes (28 juni 2003)
De meeting kan niet als "fascistisch" beschouwt
worden, daar verschillende sprekers het fascisme als
een speciale vorm van "etatisme" grondig becritiseerd
hebben. Die sprekers waren mensen met een grondig christelijk-katholieke overtuiging. De meeting was dus pluralistisch, misschien niet het zelfde pluralisme als in het Belgisch of het Vlaams of het Waals Parlement, maar toch een pluralisme met onverzoenbare verschillende posities, die tegenover elkaar paal staan.
“De rechtse oppositie tegen Hitler” is de titel van
een boek van de Duitse journalist Claus-M. Wolfschlag
(zijn andere boeken betreffen architectuur, ecologie
en de 68-beweging...). In dat boek beschrijft
Wolfschlag het tragieke lot van verschillende
conservatieve, christelijke of volkslinkse
slachtoffers van Hitlers regime, o. a. de weerstanders
van de “Witte-Roos-Beweging" die onder de guillotine
in München gestorven zijn. Alle mensen over wie
Wolfschalg erover heeft zijn zuivere anti-fascisten.
De gek, die het stuk over de Rijselse meeting
geschreven heeft en de andere zot, die over de
spreekbeurten van Synergon's zomeruniversiteit het
heeft, zijn blijkbaar een soort van mutanten :
anti-fascisten die andere anti-fascisten als fascisten uitschelden. De nedergang in richting "nog meer stomiteit” kent werkelijk geen grenzen meer.
De studie van Wolfschlag is dus niet bepaald
pro-Hitleriaans, of vindt niet dat Hitler te weinig
rechts staat. De begrippen "links" en "rechts" in een
zo onzinnige manier te hanteren leidt tot pure
nonsense.
Evola als een fascistische theoreticus beschrijven is
even gek, nog gekker. Evola was (en blijft) een grote specialist van het boeddisme (“La dottrina del
risveglio") en de eerste Italiaanse vertaler van de
Chinese Tao Te King. Evola verdedigde een multikultuur
van niveau en van kwaliteit. Is de gekke schrijvelaar
van het bovengenoemd stuk wel bekwaam van zo een
gigantisch werk te begrijpen, over hetwelke ik nog
niets durf schrijven na 30 jaar studie (ik kreeg mijn
eerste boek van Evola als Kerstmis-geschenk in
december 1973, toen ik een 17-jaarse scholier was)? En
zijn soortgenoten van het "Centrum voor gelijke kansen
en ander gezever van blablabla boem-boem-boem", sedert
enkele jaren schitterende ambtenaren van de Belgische
Onstaat? Zouden ze niet beter Evola lezen dan flauwe
slogans uit te vinden, bv om een zinnige dialoog te
starten met onze mede-burgers van Chinese of Indiase
afkomst en zelfs met Muslims (op internet vindt u
interessante bemerkingen over de Turkse en
Indonesiaanse uitgaven van Evola)? Trouwens, verstaat bovenvermelde schrijvelaar-klootzak Italiaans, om werkelijk Evola's boeken onder de loepe te nemen? Hij schijnt daarvoor veel te dom te zijn... Ei, garçon, pillekes met fosfoor voor dat jongetje... Conclusie : hij zou dus serieuze literatuur aan serieuze mensen overlaten.
Om ermee te lachen : Evola de theoreticus, Mussolini
of Hitler als mannen van de daad. Evola schrijft over boeddhisme en Mussolini of Hitler zetten zich op de grond of op een kleurrijke tapijt in de Lotus-positie en steken zich een diamant in de navel... Wat een tafereel ! Dat is dus het niveau van zulke beweringen...
Er wordt ook een zekere Meneer De Zutter geciteerd.
Wel, ik zeg dat die Meneer De Zutter stapelgek is. Het
bewijs ervan? Zijn artikel uit De Morgen (26 mei
1999). Waar zou ik die afschuwelijke zin geschreven
hebben? Bewijzen, bronnen, a.u.b. Of morgen een klacht
bij de rechter (hoera, eindelijk wat centen
verdienen...). Dat deze Meneer De Zutter rap bij zijn huisdokter loopt, om een medisch attest te gaan halen, waar duidelijk vermeld wordt, dat hij aan hallucinaties lijdt. Te veel cannabis, misschien...? De Winter heeft toch gelijk, dat is slecht voor de geestelijke gezondheid. Evola lezen is zeker en vast beter.
Robert Steuckers.
13:36 Publié dans Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Polonais et Tchèques contre les missiles US

Les Polonais opposés au bouclier antimissile américain dans leur pays
(AFP, 23 avr 07) Le projet d’installer en Pologne des éléments du bouclier antimissile américain suscite l’opposition de 57 pc des Polonais, alors que 25 pc y sont favorables, selon un sondage publié lundi.
Dix-huit pour cent des personnes interrogées n’avaient pas d’opinion, selon ce sondage de l’institut CBOS, réalisé du 30 mars au 2 avril auprès d’un échantillon de 937 Polonais adultes.
Le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, était attendu mardi à Varsovie pour discuter de cette question avec les responsables polonais. Le Premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski a récemment déclaré que la Pologne voulait que des éléments du bouclier antimissile américain soient installés sur son territoire, “mais pas à n’importe quel prix”, sans autres précisions.
Les Etats-Unis veulent installer en Pologne dix missiles intercepteurs et un radar ultra-perfectionné en République tchèque, des éléments de leur bouclier antimissile. Ce projet a été très mal accueilli par la Russie qui y voit une atteinte directe à sa sécurité.
L’opinion publique tchèque n’est guère plus favorable aux projets américains. Plus de trois Tchèques sur cinq (61 pc) sont opposés à l’installation de la station radar, selon un récent sondage de l’institut CVVM.
Article printed from AMIBe: http://be.altermedia.info
URL to article: http://be.altermedia.info/politique/les-polonais-opposes-au-bouclier-antimissile-americain-dans-leur-pays_6367.html
13:07 Publié dans Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Citation d'Aldous Huxley
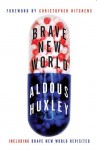
"[…] par le moyen de méthodes toujours plus efficaces de manipulation mentale, les démocraties changeront de nature. Les vieilles formes pittoresques - élections, parlements, hautes cours de justice - demeureront mais la substance sous-jacente sera une nouvelle forme de totalitarisme non violent.
Toutes les appellations traditionnelles, tous les slogans consacrés resteront exactement ce qu’ils étaient au bon vieux temps, la démocratie et la liberté seront les thèmes de toutes les émissions radiodiffusées et de tous les éditoriaux mais […] l’oligarchie au pouvoir et son élite hautement qualifiée de soldats, de policiers, de fabricants de pensée, de manipulateurs mentaux mènera tout et tout le monde comme bon lui semblera."
Aldous Huxley - Retour au meilleur des mondes - 1959
06:15 Publié dans Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
W. Benjamin & le mythe du "Progrès"

Walter Benjamin a démonté le mythe du “Progrès”
De nouvelles hypothèses sur la mort du philosophe juif-allemand : a-t-il été assassiné sur ordre de Staline?
26 septembre 1940: Walter Benjamin, philosophe et critique littéraire, Juif de nationalité allemande, pris au piège dans la France de Vichy, réussit a obtenir à Marseille un visa pour les Etats-Unis. Mais le groupe de réfugiés, auquel il se joint à Port Bou, sur la frontière espagnole, trouve la frontière fermée. Pendant la nuit, après avoir écrit une lettre à son ami Théodore Adorno, Benjamin absorbe un poison qui lui ôte la vie.
Stephen Schwartz, journaliste et historien américain du communisme, vient d'affirmer, ces jours-ci, que Walter Benjamin a fort probablement été assassiné sur ordre de Staline. Schwartz a pu réfuter le témoignage de Henny Gurland, la femme, qui, à l'époque, accompagnait le philosophe et avait affirmé que celui-ci s'était suicidé parce qu'on lui avait refusé l'entrée sur le territoire espagnol. D'après Schwartz, Staline aurait ordonné l'assassinat de Benjamin parce que le philosophe, qui avait été l'un de ses principaux fidèles, était devenu anti-communiste depuis le Pacte germano-soviétique de 1939, pacte scellant l'alliance entre l'Union Soviétique et l'Allemagne nationale-socialiste. La solution à ce mystère se serait trouvée dans le manuscrit que le philosophe avait transporté d'Allemagne en France et s'apprêtait à emmener avec lui en Espagne puis aux Etats-Unis. Ce manuscrit a mystérieusement disparu.
Des lunettes sur le nez, l'automne au cœur
Par-delà toutes les hypothèses plus ou moins sérieuses ou fantaisistes que l'on émet à son sujet, Walter Benjamin reste un personnage d'une grande importance historique. «L'intellectuel est un homme avec des lunettes sur le nez et l'automne au cœur» : plus que tout autre citation, cette phrase nous aide à comprendre le drame humain de ce grand protagoniste du débat culturel du siècle qui vient de s'écouler.
Né à Berlin en 1892, il a étudié la philosophie d'abord à l'université de sa ville natale, puis à Munich et à Berne. Walter Benjamin a commencé à jouir d'une certaine notoriété en collaborant aux principales feuilles littéraires d'Allemagne. Il termine ses études et obtient son diplôme en 1918, mais n'obtint aucune chaire et dut se contenter de la position de précepteur libre, malgré qu'il ait présenté aux autorités universitaires un texte, considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre: « Le drame dans le baroque allemand ».
Un “marxisme” contrebalancé par des études sur la mystique juive
Son intarissable inquiétude existentielle l'a poussé, depuis sa jeunesse, à voyager à travers toute l'Europe, avec de longs séjours à Paris, sa ville de prédilection, tout en s'immergeant dans une recherche du point de convergence entre le messianisme juif et l'internationalisme prolétarien, entre le sionisme et le communisme. En 1926, il pense adhérer au parti communiste allemand, mais, finalement, ne se décide jamais, encore moins après la prise de pouvoir par Hitler en 1933-34. L'histoire de son amour pour Asja Lacis, à la suite de sa séparation d'avec sa femme Dora Pollak, a contribué, tout comme son amitié avec Brecht, Bloch, Lukacs et Adorno, à le rapprocher du communisme. Cependant son amitié avec Gershom Scholem, principal exposant de la mystique juive, a contrebalancé l'influence du marxisme, infléchissant sa pensée dans un sens plus religieux. Mais à l'élément religieux de la pensée de Benjamin s'opposait une préoccupation toute différente : l'avancée des fascismes, qui semblait irrésistible et qui le poussait vers le communisme. Benjamin, dans le fond, est resté à mi-chemin entre Moscou et Jérusalem, entre la philosophie marxiste et la mystique juive. Comme Kafka —à qui il consacrera en 1934 un essai devenu célèbre— Benjamin pensait, de manière obsédante, à la nécessité d'apprendre l'hébreu moderne et à la possibilité de se réfugier en Palestine, où il espérait enseigner les littératures française et allemande. Sa voie personnelle le conduisit continuellement à se rapprocher du sionisme et du judaïsme orthodoxe; il s'en est rapproché toute sa vie, mais ne l'a jamais atteint, sans nul doute à cause de sa mort prématurée.
Après l'avènement du national-socialisme en Allemagne, Benjamin a renforcé sa propre tendance au nomadisme, en s'installant d'abord à Paris, puis à Ibiza, puis, ensuite, au Danemark, où il fut l'hôte de Bertold Brecht. Ses œuvres fondamentales sont : «Pour une critique de la violence » (1921), « La tâche du traducteur » (1923), « Les affinités électives chez Goethe » (1925), « Origines du drame allemand » (1928), « Karl Kraus » (1931), «L'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique » (1936).
Un poison donné par Arthur Koestler
En 1938, il apprend que son frère Georg, opposant au nazisme, est mort à Mauthausen, après quatre années de détention. En septembre 1939, les troupes nationales-socialistes allemandes envahissent la Pologne, ce qui déclenche la seconde guerre mondiale. Benjamin, comme bon nombre d'autres réfugiés, est arrêté par les autorités françaises de la IIIe République et interné dans un “camp de rassemblement”, où il restera deux mois, avant d'être libéré grâce à l'intervention de quelques amis. Décidé à traverser la frontière espagnole, Benjamin transportait avec lui du poison qui lui avait été donné par son ami Arthur Koestler à Marseille. Il pensait en faire usage au cas où il serait tombé aux mains de la Gestapo. Mais quand à Port Bou, les gardes civils espagnols ferment la frontière et interdisent aux réfugiés de la franchir et menacent de les refouler en France, ses nerfs craquent. Pendant la nuit, il met fin à ses jours. Du moins probablement. Il avait 48 ans. Après la guerre, son ami Théodore Adorno, philosophe et musicologue de réputation mondiale, fera connaître au grand public l'œuvre de Benjamin, exactement comme Max Brod l'avait fait pour Kafka.
Une pensée où coexistent deux filons
Dans la pensée de Walter Benjamin coexistaient deux filons : le filon religieux et le filon politique; il y avait donc son intérêt pour la mystique juive et son attirance pour la philosophie marxiste. Le grand philosophe et critique littéraire ne fut toutefois pas un juif orthodoxe, comme il ne fut jamais non plus un véritable militant communiste. Dans sa pensée, ces deux références alternent continuellement sans jamais, pourtant, donner vie à une réelle fusion, comme ce fut le cas dans l'œuvre de son ami Ernst Bloch, pour qui la religion juive nourrit le messianisme marxiste. Bloch a “immanentisé” le judaïsme (et le christianisme), en en faisant des tentatives eschatologiques de dépassement de l'injustice sur terre; ce sont ces veines religieuses qui enrichissent l'aspect messianique bien présent dans la pensée de Marx. Benjamin a commencé par se fermer à la religion, pas ne pas dépasser un stade simplement mystique et pour relier celui-ci à une perspective messianique. Le marxisme, il ne s'en sert que pour nier la réalité présente, plus que pour proposer une réelle alternative politique.
En même temps, sans se décider à s'installer à Jérusalem, il demeure fasciné par l'expérience sioniste en Palestine, suscitant, à ce propos, la colère de son ami Bertold Brecht, qui l'accuse de soutenir un “fascisme juif”.
Dix-huit aphorismes sur la philosophie de l'histoire
Benjamin, déjà bien avant le pacte Ribbentrop/Molotov, ne voyait plus Moscou comme une véritable alternative à Jérusalem. Le communisme n'avait de valeur, pour lui, que comme force anti-capitaliste et anti-nazie, non pas comme une force politique autonome. Témoignage de son hérésie idéologique, qui le faisait souffrir : les dix-huit aphorismes de ses “thèses sur une philosophie de l'histoire”, où il prend son inspiration dans le tableau “Angelus Novus” de Paul Klee et attaque le mythe du progrès, dont les origines résident dans la pensée des Lumières, et qui imprègne aussi le marxisme. Benjamin ne croit pas au Progrès qui s'est substitué, dans la conscience des hommes, à la Providence divine. Le progrès est une idolâtrie qui illusionne les hommes, désormais éloignés de la vérité parce qu'éloignés de la perspective religieuse. Par ce refus du mythe fondateur de la modernité se clôt la parabole humaine et la trajectoire intellectuelle de ce grand homme de culture, partagé entre sa fascination pour la lutte politique et sa fidélité, non orthodoxe, à la foi de ses pères.
Martino MORA.
(article paru dans La Padania, 18 juillet 2001; http://www.lapadania.com ).
06:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Reichsidee und europäische Neuordnung

Reichsidee und europäische Neuordnung
Von Jürgen Schwab
Gefunden auf: http://www.die-kommenden.net/
"Eine Träne für das alte Reich" vergoß unlängst Michael Stürmer. Der etablierte bundesrepublikanische Historiker ließ sich zu dieser Gefühlsregung ausgerechnet in seiner Kolumne hinreißen, die in der Tageszeitung Die Welt erscheint. [1] Das Springer-Blatt, das laut seines Tendenzschutzes der Freundschaft mit den USA und Israel verpflichtet ist, hat sich bislang nicht als Forum für Reichspatrioten positioniert. Gerade deshalb ist es bemerkenswert, daß Stürmer in dieser Zeitung schreibt:
"Im Vergleich mit dem Absolutismus in Frankreich, Spanien oder Schweden oder mit der britischen Parlamentsoligarchie war das alte Reich Inbegriff des Pluralismus, des friedlich-schiedlichen Ausgleichs, des Genossenschaftswesens und der Rechtlichkeit. [...] Es gab nach 1945 wahrhaftig Grund, die NS-Diktatur als soziale Revolution und Nihilismus zu begreifen. Zehn Jahrhunderte deutscher Geschichte aber als zwanghafte Vorgeschichte abzutun - dazu bestand kein Grund." [2]
Das Zitat Stürmers macht deutlich, daß den Deutschen ihre Geschichte und vor allem ihre über 1.000 Jahre andauernde Reichsgeschichte gestohlen wurde. Die Ursache dafür reicht bis zur alliierten Konferenz von Teheran vom 28. November bis zum 1. Dezember 1943 zurück. Bei diesem Treffen gab US-Präsident Franklin Delano Roosevelt das psychologische Kriegsziel aus, daß nach dem Sieg über Deutschland das "Konzept des Reiches" nicht im Bewußtsein der Deutschen bleiben dürfe und dieses Wort "Reich" aus der Sprache der Besiegten gestrichen werden solle. In einem Momorandum für den US-Außenminister vom 6. April 1945 bekräftigte Roosevelt noch einmal sein Vorhaben, das Wort "Reich" aus dem deutschen Sprachschatz zu eliminieren.[3] Diese linguistische Entmündigung sollte schon alleine als Herausforderung für gegenwärtige deutsche Denker gelten.
Reichsbegriff und Reichsidee
Vom religiösen und mythologischen Bedeutungsgehalt einmal abgesehen, so ist das Reich die politische Ordnung, in der die Deutschen seit über 1.000 Jahren lebten. Der Begriff "Reich" ist laut Herkunftswörterbuch des Duden-Verlages germanisch-keltischen Ursprungs und bedeutete so viel wie "Herrscher, Fürst, König". Somit wäre der Begriff "Reich" personifizierbar in einer Herrschergestalt. Daneben trat die Bedeutung im Sinne von "einem Herrscher untertäniges Gebiet, Herrschaftsbereich", was einem Territorium gleichkommen würde. Zudem galt auch noch die ganz allgemeine Bedeutung von "Herrschaft, Macht". Im Deutschen bezeichnete das Wort einerseits das (deutsche) "Reich", andererseits auch die Stände des Reiches - somit also sowohl die Gesamtheit des Reiches als auch seine territorialen Bestandteile.[4]
Der Reichsbegriff selbst sollte heute allerdings im öffentlichen Raum sparsam verwendet werden, da die Gegenwartsdeutschen - außerhalb kleiner nationaler Zirkel - mit ihm nichts mehr positives, sinnstiftendes verbinden können. Deshalb hat auch der Verfasser in der vorausgegangenen Begriffsbestimmung durchgehend die Vergangenheitsform gewählt. Vermutlich würde bei einer gegenwärtigen Umfrage herauskommen, daß das ,Reich' für ,Hitler' und ,Auschwitz' stehe, also für ein Zerrbild des Dritten Reiches. Würde man heute einer nationalen Partei empfehlen, mit dem Begriff des ,Reiches' Wahlkampf zu betreiben, also Plakate und Flugblätter zu beschriften, so würde man diese zur Erfolglosigkeit einladen. Was von Reichspatrioten gut gemeint sein mag, kann auf einer vorschnell eröffneten "Reichsspielwiese" [5] Schaden nehmen. Solange die Reichsidee in Vergessenheit geraten ist, sollte man mit der bloßen Worthülse vom ,Reich' nicht hausieren gehen.
Die vielfältige Reichstradition
Viel einfacher als die Frage zu beantworten, was die Reichsidee in ihrer Vielfalt bedeutet, dürfte zu erklären sein, was mit ihr unvereinbar ist. Für den amtierenden Außenminister der BRD, Joseph Fischer, steht fest: "Kein Land ist gegenwärtig so wenig reichsorientiert wie die Bundesrepublik Deutschland." [6] Den Grund hierfür nennt uns einer der Väter des BRD-Grundgesetzes Carlo Schmid (SPD), der die BRD "als die Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft" bezeichnete.[7] Die BRD ist also das Anti-Reich auf deutschem Boden, auch wenn das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil von 1973 erklärte, [8] daß die BRD zwar nicht als "Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches, aber dennoch "teilidentisch" mit ihm sei. Die vermeintliche Teilidentität soll wohl erklären, daß irgend ein pseudostaatliches Gebilde nach 1945 für diverse ,Wiedergutmachungsforderungen' und ,Gebietsabtretungen' der Ansprechpartner darstellen mußte. Demgegenüber sind sowohl die BRD als auch die (bereits verblichene) DDR und die RÖ Reichszerteilungsstaaten, die - als bloße Teilnachfolger - niemals völkerrechtlich legitimiert sind, für das Deutsche Reich - als Ganzes - zu sprechen, das seit der von den Alliierten vorgenommenen Verhaftung der Reichsregierung Dönitz am 23. Mai 1945 handlungsunfähig ist. Zumindest in diesem einen Punkt, der völkerrechtlichen Lage Deutschlands, kommt eine Fundamentalopposition um den Reichsbegriff nicht herum. Der mögliche Hinweis, das Dritte Reich habe die Reichsidee verfehlt, wäre an dieser Stelle irreführend, da es hier ausschließlich um den Traditionsbruch seit dem 23. Mai 1945 und die völkerrechtliche Position geht, die zu verteidigen ist. Mit dieser völkerrechtlichen Feststellung ist selbstverständlich nicht gesagt, daß gegenwärtige Reichspatrioten systempolitisch an das Dritte Reich anknüpfen sollten.
Grundsätzlich ist der Reichsbegriff ein offener Begriff, der nicht begrifflich eindeutig und widerspruchslos festlegt werden kann. Die Reichsidee ist vielfältig, besitzt mehrere Traditionsstränge und ist nicht selten widersprüchlich. Eine ausschließliche Fixierung auf eine alternative nationalstaatliche Ordnung der Deutschen, verfehlt den Bedeutungsgehalt des Reichsbegriffs deshalb, weil hierbei zum einen der supranationale Bezug der Reichsidee komplett unterschlagen wird, zum anderen geht die Frage nach der geeigneten Staats- und Regierungsform am Thema vorbei, da die Reichsidee in dieser Hinsicht geschichtlich völlig offen ist. Denn in der über 1.000 Jahre langen (deutschen) Reichsgeschichte finden wir - bezogen auf das Gesamtreich - Epochen der Erbmonarchie ebenso vor wir wie solche der Wahlmonarchie, bei der die Kurfürsten den deutschen König wählten. Hinzu kommen in der jüngeren Zeit republikanische Phasen - wie die Weimarer Republik und das Dritte Reich.
Zudem hat das ,Reich' eine metaphysische bzw. religiöse Dimension. Und auch bei dieser Thematik gibt es verschiedene Traditionsstränge. Mit der Reichsgeschichte verbunden ist die Geschichte der zunächst heidnischen germanischen Stämme ebenso wie das abendländische Christentum. Zu dieser reichen Kultur des Reiches gehören demnach die ,betenden Hände' Albrecht Dürers, die christlich inspiriert sind, ebenso wie das germanische Nibelungenlied.
Die Frage, welche Religion eines Tages wieder im Reich vorherrschen wird, dürfte offen sein. Wahrscheinlich wird weder das Christentum noch das Heidentum die allein vorherrschende Religion sein, sondern beide werden sich als Teile eines erneuerten Ganzen, einer neuen Reichstheologie begreifen müssen, derzufolge der Staat als Repräsentant des allgemeinen Interesses über den besonderen Interessen von Kirchen und Verbänden stehen wird. Wir sollten heute vielmehr im Sinne von Georg Wilhelm Friedrich Hegels Philosophie der Geschichte [9] sowohl das germanische Heidentum als auch das Christentum als lediglich historisch-geistige Entwicklungsstufen begreifen, die das deutsche Volk und die europäischen Völker insgesamt hindurchzugehen haben, um diesen Religionstypen in ihrer ursprünglichen Form allmählich zu entschlüpfen, damit - in dialektischer Weise - aus dem zuvor bestandenen, Heidentum (These) und Christentum (Antithese), ein neues Drittes (Synthese) entstehen kann.
Nach dieser Einschätzung wird es hinter das Jahr 496 nach Christi kein zurück geben, als der Franken-König Chlodwig I. den katholischen christlichen Glauben annahm und somit den Abfall der Germanen vom Heidentum einleitete. Dieser Katholizismus überwand daraufhin das arianische Christentum, dem einige Stämme, vor allem der Ost-Germanen anhingen. Aber es wird auch hinter das Jahr 1517 kein Zurück geben, als Martin Luther seine ,95 Thesen über den Ablaß' an das Tor der Wittenberger Schloßkirche schlug. Denn von nun an gibt es zumindest zwei christliche Konfessionen in Deutschland und dazu noch manche Anhänger des Heidentums, von denen alle nicht behaupten können, die Mehrheit der Deutschen hinter sich zu haben, von den vielen Konfessionslosen, die keiner Kirche angehören, wie der Verfasser, einmal abgesehen.
Welche Völker umfaßt das Reich?
Umstritten ist ebenso, ob der Reichsbegriff auch im Plural oder ausschließlich im Singular zu wenden ist. Hiermit ist nicht in ersten Linie der Sinn oder Unsinn einer chronologischen Abfolge gemeint (Erstes, Zweites, Drittes Reich), sondern die globale Dimension. Kann es neben einem deutschen bzw. mitteleuropäischen Reich noch andere Reiche geben? Carl Schmitt plädierte dafür, den Reichsbegriff in das Völkerecht aufzunehmen [10], womit klar sein dürfte, daß der deutsche Völkerrechtler die Existenz mehrerer Reiche voraussetzte, womit die christlich-mittelalterliche Vorstellung von dem einen Reich, das es universal nur geben könne, durchbrochen wäre.
Vielfältig sind auch die Möglichkeiten der geopolitischen Erstreckung der - auf Europa bezogenen - Reichsidee. Der Verfasser hält allerdings die Vorstellung, das ,Reich' an sich müsse sich territorial auf Gesamteuropa erstrecken bzw. Europa habe ein ,Reich' zu sein [11], für nicht zutreffend. Noch utopischer wird es, wenn uns Martin Schwarz "Eurasien als Nation" verkaufen möchte. [12] Wir sollten vielmehr davon ausgehen, daß Europa aus mehreren Reichen bestehen kann, da es potentiell auch mehrere europäische hegemoniale Ansprüche gibt. So trifft sich die deutsch-österreichische Hegemonialbestrebung mit der italienischen, russischen und türkischen auf dem Balkan [13], die deutsche und die französische in der Schweiz, in Elsaß-Lothringen und auf den Territorien der Benelux-Staaten, die deutsche und die russische im Baltikum und der deutsch-österreichische Gebietsanspruch mit dem italienischen in Südtirol - um nur wenige Beispiele zu nennen.
Wenn wir Rußlands nichteuropäische Gebiete mitberücksichtigen, wäre die Vorstellung von einem "Reich Europa" umso mehr absurd. Natürlich müßte es uns darum gehen, - um es in der Sprache Carl Schmitts auszudrücken - eine völkerrechtliche Großraumordnung zu denken, die von Lissabon bis Wladiwostok reicht. In diesem Großraum hätte der Grundsatz vom "Interventionsverbot für raumfremde Mächte" zu gelten. [14] Die Pervertierung eines solchen Konzept bestünde lediglich in der irrigen Annahme, ein solcher Raum könnte dauerhaft von einer Hauptstadt aus regiert und befriedet werden. Dieses auf Dauer zum Scheitern verurteilte Unternehmen wurde bereits viermal in der Geschichte versucht: Von Rom aus versuchte dies Julius Cäsar, von Paris aus Napoleon, von Berlin Adolf Hitler und von Moskau Josef Stalin. Der Versuch, Europa dauerhaft von einer Hauptstadt aus zu regieren, kann dauerhaft nicht gelingen, weil dies die Kräfte eines einzelnen Reichsvolkes übersteigen würde und zudem nur mit erheblichem Zwang, sprich Unterdrückung gegen die Völker verbunden wäre. Deshalb ist eine auf Gesamteuropa, zuzüglich Sibirien angelegte Großraumordnung immer in mehren hegemonialen Teilräumen zu denken, die von zumindest drei Hauptstädten bestimmt wird. Naheliegend ist dabei die Achse Paris-Berlin-Moskau. Was die Berliner und Wiener Perspektive, also die deutsche Reichsidee betrifft, so bestehen geschichtlich zumindest fünf geopolitische Räume. Natürlich ist es - lagebedingt - in dem ein oder anderen Fall möglich, die Ansätze zu kombinieren:
1. Der kerneuropäische Raum: Das wäre Deutschland und seine westlichen Nachbarn, also Deutschland, Frankreich und die Beneluxstaaten. Das entspräche in etwa dem alten Frankenreich ohne Reichsitalien.
2. Der zwischeneuropäische Raum: Das wäre der Raum ,zwischen' Deutschland und Rußland, also Deutschland und seine östlichen Nachbarn, Ostmitteleuropa und der Balkan. Hiermit würde man die Idee der Ostkolonisation von Preußen und Österreich wieder aufgreifen. Es würde sich dabei um eine heterogene Völkergenossenschaft handeln: germanische sowie west- und südslawische Völker. Hinzu kämen Esten, Ungarn, Rumänen und vielleicht noch kleinere muslimische Völker (u.a. Bosnien).
3. Die südliche Erstreckung: Das wäre Deutschland und Italien. Geschichtlich könnte man hier ans mittelalterliche Reich, vor allem an das der Hohenstaufen, aber auch an die sogenannte ,Achse' Berlin-Rom von Hitler und Mussolini anknüpfen. Als Stolperstein würde sich hierbei wohl das Südtirolproblem erweisen.
4. Das großgermanische Reich: Hierbei würde der Schwerpunkt auf dem Rassebegriff liegen. Geographisch wäre das vor allem Deutschland und seine nördlichen Nachbarn: Dänemark, Norwegen, Schweden, aber auch die Niederlande (Holland und Flandern). Kritisch zu hinterfragen wäre, ob Deutschland und Skandinavien überhaupt eine geopolitische Einheit bilden. Der Hinweis von großgermanischen Propagandisten, auch romanische und slawische Völker könnten in ein solches Konzept eingebunden werden, ist reine Wunschvorstellung, da diese Völker sich immer als zweitklassig in einem explizit großgermanischen Reich empfinden werden. Noch so gut gemeinte Entkräftungsargumente wie: Die Spanier haben die Westgoten, die Norditaliener die Langobarden, die Nordfranzosen die Franken, die Polen die Vandalen, die Russen und Ukrainer die Waräger als Vorfahren, gehen ins Leere und werden dort als ,Pangermanismus' interpretiert.
5. Der nordeurasische Großraum: Das heißt Europa, einschließlich Rußland und Sibirien. Dieser großräumige Ansatz wurde bereits eingangs dieser Betrachtung angesprochen. Ein solches Konzept ist nicht mittels einer festgefügten Reichsordnung, sondern nur mittels einer Achse, durch einen loseren Verbund mehrerer hegemonialer Sphären möglich. Als Vordenker können wir Carl Schmitt [15], Ernst Jünger [16] und Ernst Niekisch anführen. Niekisch plädierte für eine germanisch-slawische Synthese, die sich allerdings gegen den Westen, gegen das romanische Europa und die angelsächsische Welt zu richten hätte. [17]
Kaiser- und Königreich zugleich
Ein Reich benötigt eine klare Herrschaftsstruktur, die vor allem von einer Unterscheidung von Zentrum und Peripherie auszugehen hat. Im Zentrum steht immer das Reichsvolk, das die Reichsgenossen in der Peripherie führt. Die Reichsfähigkeit ist dann gegeben, wenn die Führenden ihre Verantwortung für das Ganze und die Geführten den Nutzen aller erkennen und Überheblichkeit und Unterdrückung im Bewußtsein beider Seiten ausbleiben.
Am Anfang aller Bemühungen sollte die Herrschaftsfähigkeit des Reichsvolkes stehen. Solange der deutsche Kern - gerade auch in bevölkerungspolitischer Sicht - weiterhin dahinfault, sind alle - oben genannten - geopolitischen Varianten reine Luftschlösser. Erst wenn der deutsche Kern wieder kernig geworden ist, also alle Spielarten von Fremdherrschaft und Verausländerung (wirtschaftlich, kulturell, militärisch und bevölkerungspolitisch) abgeschüttelt sind, wird sich alles weitere - eine begabte Regierungsmannschaft vorausgesetzt - von selbst ergeben. Die oben genannten geopolitischen Möglichkeiten wären dann je nach Lage umsetzbar. Zuallererst müssen jedoch die Deutschen wieder staatsfähig werden. Deshalb ist die Wiedergewinnung eines souveränen Nationalstaats die Grundvoraussetzung und eben nicht der Widerspruch zur Verwirklichung der Reichsidee. Das (deutsche) Reich ist deshalb Nationalstaat und überstaatlicher Großraum zugleich. Die Verwirklichung der Reichsidee ist freilich erst mit Erreichen des letzten (überstaatlichen) Stadiums gegeben.
Daß beide Pole des ordnungspolitischen Denkens der Deutschen zwingend aufeinander angewiesen sind, lehrt uns das Lexikon des Konservatismus , das dem Reichsbegriff Gültigkeit zumißt - "gleichlautend sowohl für das Regnum wie für das Imperium [...]." [18] So war ja der oberste weltliche Herrscher des ,Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation' deutscher König und römischer Kaiser zugleich; und daneben hatte er noch andere Titel, wie die Hohenstaufen Herzöge von Schwaben waren. Der ,deutsche König' war im Prinzip der vormoderne Vorgänger des Staatsoberhauptes des deutschen Nationalstaates, als ,römischer Kaiser' jedoch hatte er einen übernationalen und überstaatlichen Herrschaftsanspruch, der dem Ideal nach die gesamte Christenheit, also damals das gesamte europäische Abendland umfaßte.
Mit dem Titel des ,römischen Kaisers' war die Idee der translatio imperii verbunden, derzufolge es nur ein Reich geben könne und dieses Reich von den Römern an die alten Franken des fränkischen Gesamtreiches und von diesen auf die Deutschen des Ost-Frankenreiches übertragen worden sei. Die Deutschen haben dieses Reich inne seit der Kaiser-Krönung Ottos des Großen im Jahre 962. Einen gesamtdeutschen König haben wir bereits seit dem Jahr 911, als Konrad I. von den deutschen Herzögen zum deutschen König gewählt wurde. Somit reicht sowohl die deutsche Reichstradition als auch die Tradition des deutschen (vormodernen) Nationalstaats jeweils bis ins 10. Jahrhundert zurück. In diesem Sinne hat das ordnungspolitische Denken der Deutschen zwischen dem Nationalstaat und der supranationalen Reichsidee zu verlaufen. Zwischen diesen beiden Extrempolen muß die richtige Mitte gefunden werden. Wer das ,Reich' nur als Nationalstaat versteht, würde einer erneuten ,Einkreisung' Deutschlands das Wort reden, wobei am Ende der Entwicklung das finis germaniae stehen würde. Hingegen ein supranationales Reich, dem ein staatsfähiger deutscher Kern fehlen würde, käme einem handlungsunfähigen "Monstrum" gleich, das bereits Samuel Pufendorf im Heiligen Römischen Deutscher Nation erkannt hatte [19], das - nach dem Niedergang der Dynastie der Hohenstaufen (nach 1254) - zwar viel Transzendenz, aber wenig Herrschaft besessen hatte.
Dieses Verhängnis ist dann in den folgenden Jahrhunderten durch die unselige Hausmachtpolitik der Habsburger, die den deutschen Kern vernachläßigte, und durch die eigensinnige Reichsfeindlichkeit der Hohenzollern, die vor räuberischen Überfällen (1741 auf Schlesien) und Bündnissen mit Frankreich und England nicht zurückschreckte, auf die Spitze getrieben worden. Als dann aus den reichsfeindlichen Piefkes Reichspatrioten geworden waren, näherte sich das kleindeutsche Bismarckreich (1871-1918) strukturell dem von vielen Deutschen lange ersehnten Ideal des Nationalstaats an. Daß Österreich aus diesem kleindeutschen Reich ausgegrenzt blieb und dieses Gebilde auch sonst wenig der überstaatlichen Perspektive der Reichsidee entsprach, ist wohl im ersten Falle der geschichtlichen Notwendigkeit, im zweiten der Übermacht an Feinden zuzuschreiben gewesen, der sich das Zweite Deutsche Kaiserreich - im Zweibund mit Österreich-Ungarn - im Ersten Weltkrieg (1914-1918) leider nicht erfolgreich erwehren konnte.
Auch der Weltkriegsteilnehmer Adolf Hitler scheiterte gut zwei Jahrzehnte später an einer Übermacht an Feinden. Freilich war die totale Niederlage im Jahr 1945 auch auf das eigene Versagen zurückzuführen. Der Sieg wäre immerhin möglich gewesen, wenn man zum einen rechtzeitig erkannt hätte, daß - gerade im Verhältnis zu den angelsächsischen Mächten - der Rassebegriff zwar ein naturwissenschaftlicher, aber eben kein politischer (Gemeinschafts-) Begriff ist. Zum anderen hätte man - zugunsten der eigenen Glaubwürdigkeit - das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das man ein paar Jahre zuvor aus der Position der Schwäche gegenüber dem System der Pariser Vorortverträge selbst eingefordert hatte, in der Position der Stärke angekommen, auch anderen, vor allem den slawischen Völkern zugestehen müssen. [20] - Aus dieser Fülle an über 1.000jähriger reichischer Erfahrungen sind die Lehren für eine künftige deutsche Reichspolitik zu ziehen. Die Umsetzung derselben bedingt freilich den globalen Sturz des Gegenreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika.
Fußnoten:
[1] Michael Stürmer in Die Welt vom 16.10.2003
[2] Ebd.
[3] Quelle: Die F. D. Roosevelt-Papers, einzusehen in der F.D.R.-Library: roosevelt.liberary@nara.gov
[4] Günther Drosdowski (Hg.): Duden. Das Herkunftswörterbuch, Bd. 7. 2. Auflage, Dudenverlag, Mann heim/Wien/Zürich 1989, S. 581
[5] Hans-Dietrich Sander in Staatsbriefe 2/2000
[6] Joseph Fischer im Gespräch mit dem französischen Politiker Jean-Pierre Chevènement, veröffentlicht in Die Zeit, Nr. 26/2000
[7] Rede des Abgeordneten Dr. Carlo Schmid im Parlamentarischen Rat, am 8. September 1948. A ufgezeichnet in "Der Parlamentarische Rat 1948-1949, Akten und Protokolle", Band 9, herausgegeben vom Deutschen Bundestag und vom Bundesarchiv, Harald Boldt Verlag im R. Oldenbourg Verlag, München 1996, Seite 20 ff. Im Archiv des Bundestages stehen die Protokolle gebunden im Büro von Günther J. Weller
[8] Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 31.07.1973 zum Grundlagenvertrag zwischen der BRD und der DDR, BVerfGE 36,1
[9] Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen der Philosophie der Geschichte. Werke 12. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 1986. S. 413-540 ("Die germanische Welt")
[10] Carl Schmitt: Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht. (Erstausgabe, Kiel 1939) Duncker & Humblot, Berlin 1991, S. 49-63 ("Der Reichsbegriff im Völkerrecht")
[11] Vgl. zu dieser Position die Schrift von Bernhard Schaub: Reich Europa. 3. Auflage im Verlag WotansWort, Kreuzlingen 2003, S. 39: "Das Reich wird, nachdem sich Europa aus der atlantischen Bevormundung gelöst haben wird, folgende geografische Gestalt haben: Es umfaßt alle europäischen Nationen, von Island bis Griechenland, von Iberien bis Finnland [...]." Rußland gehört allerdings nach dieser Konzeption nicht zum europäischen "Reich", es bildet vielmehr ein eigenes
[12] Martin Schwarz: Europa als Nation. Veröffentlicht bei: www.die-kommenden.net
[13] Die Türkei ist freilich aus europäischer Sicht als raumfremde Macht zu erkennen
[14] So der auszugsweise Titel der bereits erwähnten Schrift Carl Schmitts
[15] Vgl. ebd.
[16] Vgl. Ernst Jünger: Der Friede. Fritz Rampf, Stuttgart 1985, S. 23: "Wenn alle Vaterländer nun aus der Asche dieses [Zweiten Welt-] Krieges größer und mächtiger auferstehen sollen, so leuchtet ein, daß das nicht auf der Ebene, auf der der Kampf entbrannte, möglich ist. Der Raum- und Machtgewinn der einen darf nicht durch Minderung der anderen geschehen."
[17] Vgl. Ernst Niekisch: Europa betet. (Erstveröffentlichung 1930) Zitiert nach: Ernst Niekisch. Widertand. Ausgewählte Aufsätze aus seinen "Blättern für sozialistische und nationalrevolutionäre Politik". Uwe Sauermann (Hg.). Sinus-Verlag. Krefeld 1982, S. 43-55, hier S. 49
[18] Christoph von Thienen-Adlerflycht: Reich, in: Lexikon des Konservatismus. Caspar von Schrenck-Notzing (Hg.). Leopold Stocker Verlag, Graz 1996, S. 446-453, hier S. 446
[19] Samuel Pufendorf: Die Verfassung des deutschen Reiches. (Erstausgabe 1667) Reclam Verlag, Stuttgart 1994, S. 106
[20] Hierbei ist besonders der nationalsozialistische Imperialismus im Osten hervorzuheben, der in Heinrich Himmler, Hermann Göring, Martin Bormann und Erich Koch seine Hauptvertreter hatte. Vgl. Alfred Rosenbergs Aufzeichnungen in der Nürnberger Todeszelle, veröffentlicht unter dem Titel: Großdeutschland. Traum und Tragödie. Rosenbergs Kritik am Hitlerismus, Heinrich Härtle (Hg.). 2. Auflage im Selbstverlag H. Härtle, München 1970, S. 149 ff.
05:55 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 23 avril 2007
Kurt Eggers: Schriftsteller, Kulturrevolutionär und Soldat

Gefunden auf: http://www.deutsche-stimme.de/
Kurt EGGERS: Schriftsteller, Kulturrevolutionär und Soldat
In der heutigen orientierungslosen Zeit suchen wir Ideale vergebens. Aber in unserer Geschichte, jenseits einer satten bürgerlichen Welt, finden wir einen, der den lebensvertiefenden Kampf bejahte und damit ein stolzes Gegenbild zum heutigen Zeitgeist darstellt. Einer, bei dem Wort und Tat eine Einheit bildeten – Kurt Eggers. Es ist kein Wunder, daß die uns Beherrschenden versuchten und versuchen, die Erinnerung an ein kriegerisches Leben, im körperlichen wie auch im geistigen, auszulöschen. Kurt Eggers ist uns aber heute wieder ein Begriff, ja ein Synonym für Entschlossenheit, Klarheit und Vorwärtsdrang. Seine Schriften, sein Leben und seine Taten legen davon Zeugnis ab.
Literatur ist immer Spiegel ihrer Entstehungszeit. Vielgesichtiges kulturelles Schaffen wurde beflügelt durch zeitprägende, herausragende Persönlichkeiten, die tiefgreifende nationale und soziale Erneuerungen für ein Land und dessen Volk bewirkten. Unter dem Einfluß dieser Entstehungszeit und ihrer Ereignisse versuchten viele Literaten, die epochemachende neue Weltanschauung – die Lebensbejahung durch das Bekenntnis zur Gemeinschaft –, aber auch ihre individuellen Eindrücke und Meinungen in dramatischer, lyrischer und epischer Form darzustellen.
Kurt Eggers, mit einem umfassenden Werk aus Romanen, Erzählungen, Schauspielen, chorischen Werken, Gedichten und Liedern, schilderte sein Erleben beeindruckend mit seinen kraftvollen, allumfassenden und kritischen Worten. Die Literaten des Dritten Reiches werden allzugern von den heutigen Literaturwissenschaftlern als Ignoranten mit wertlosem Vokabular dargestellt, die das Klischee bedient hätten, der Krieg bestehe aus romantischer Kameradschaft. Mit lehrerhaften Anmaßungen wird versucht, ihr Schrifttum als kümmerlich hinzustellen, das sich in Illusionen von Ahnen- und Sippenfolklore geflüchtet habe. Doch Kurt Eggers wies nun halt einmal mit der ihm eigenen Härte den Weg zur nüchternen Wahrheit des Lebens und des Kampfes. Noch Jahrzehnte nach seinem Tod sind die damals aufgeworfenen Fragen und gestellten Forderungen aktuell, da in der deutschen Gegenwart alle Lebensfragen ungelöst dastehen und Antworten und Lösungen gefordert sind.
Diese Antworten und Anregungen kann der Leser in Eggers Worten finden. Als Sinnbild für des Nordens kriegerische Auferstehung, wird Eggers wohl deswegen immer mehr die Leitfigur der nationalen Jugend, weil er seinen stürmischen Gedanken, entgegen des erbitterten Widerstandes aller Schwachen, selbstlose Taten folgen ließ.
Deutschland zur Heimat der Starken formen
Seiner Epoche oft weite Schritte voraus, getrieben von einem inneren Verlangen, Deutschland zur Heimat der Starken zu formen, galt er immer als Aufrührer, der aus der Reihe tanzt. Zeit seines Lebens standen ihm müde Ästheten und ängstliche Greise, die ihre Bedenken erhoben, hilflos gegenüber. Als Adolf Ludwig Kurt Eggers in Berlin am 10. November 1905 das Licht der Welt erblickte, ahnte wohl niemand, daß das Leben dieses Jungen einmal unter dem Zeichen des Schwertes stehen würde, und er, getreu seiner Lebensauffassung, wie er sie in über 50 veröffentlichten Werken niederschrieb, das Leben in vorderster Front stehen sollte. Die Ursprünge der Familie Eggers, ursprünglich aus Geismar bei Göttingen kommend, lassen sich bis in das Jahr 1738 zurückverfolgen. Mit seiner aus einer ostpreußischen Bauernfamilie stammenden Mutter verband den jungen Kurt eine innige Zuneigung, wobei die Liebe zu seinem Vater, einem preußischen Bankbeamten und seiner Schwester Grete, wie Kurt Eggers es später schrieb, recht veränderlich war. Als Kurt Eggers etwa zwei Jahre alt war, zog seine Familie nach Schöneiche, einem damaligen Berliner Vorort. Dort wuchs er behütet auf und verlebte eine frohe, mit von ihm ausgeheckten Lausbubenstreichen ausgefüllte Kindheit.
Frühe Begeisterung für das Militär
Schon früh erkannte der Vater die Begeisterung seines Sohnes für das Militär und dessen unermeßlichen Wissensdurst sowie Drang, den Dingen unbedingt auf den Grund zu gehen. Als 1914 der Weltkrieg entbrannte, spürte Kurt Eggers, so schrieb er es später nieder, die erste Not seines Herzens – zu jung zu sein, um am Waffengang seines Volkes teilzunehmen. Durch die kriegsbedingten Einschränkungen und Versorgungsprobleme der Bevölkerung sah es die Familie Eggers als das Beste an, ihr Haus in Schöneiche zu verkaufen und zog 1916 wieder nach Berlin. Kurt Eggers überredete wieder einmal seine Mutter, ihn doch ins Kadettenkorps in Plön eintreten zu lassen, was aber am Einspruch des Vaters scheiterte. Erst nachdem sich seine schulischen Leistungen verschlechterten und die Schulstreiche überhandnahmen – in seiner Biographie »Der Tanz aus der Reihe« schrieb er später kurz und knapp, daß Singen und Rechnen nicht seine Stärken gewesen seien, wohl aber die Streiche – entschloß sich der Vater, seinem Sohn eine strengere Erziehung angedeihen zu lassen und schickte ihn zwar nicht zum Kadettenkorps, dafür aber auf ein Berliner Schülerschulschiff. Der Schulschiffkommandant ließ die jungen Schulschiffer nicht nur körperlich durch die harte Arbeit auf dem Schiff reifen, sondern schuf auch eine geistige Grundhaltung, die sie auf Volk und Vaterland einschwor. 1918 brach die Revolution aus, der Kaiser dankte ab, und das Reich wie Eggers es kannte und liebte, hörte auf zu existieren.
Seinem Kommandanten als Ordonnanz folgend, nahm er im Januar 1919 an der Niederwerfung der Spartakistenaufstände teil, später im März 1920 am Kapp-Putsch. Er wurde Mitglied im Deutschen Schutz- und Trutzbund und fand in kleinen Zirkeln Gleichgesinnte. Aus diesen rekrutierten sich dann auch die jungen Freikorpskämpfer, die am 21. Mai 1921 den oberschlesischen Annaberg von den Polen zurückeroberten. Unter den Freiwilligen des Selbstschutzbataillons »Schwarze Schar« Bergerhoff war auch der damals noch nicht 16jährige Meldegänger Kurt Eggers, der dem tiefen Ruf seines Blutes folgend, im Kampf gegen die Insurgenten seine Berufung zum Krieger und Soldaten erfuhr.
Heimgekehrt, wurde Eggers, der sich selbst vom Unterricht mit einer Bleistiftnotiz auf der Rückseite einer Visitenkarte beurlaubte, von der Schule geworfen, da seine Handlungsweisen sich nicht mit der Schulordnung vertrügen. Nachdem sein aufbrausendes Temperament eine kaufmännische Ausbildung schnell beendet hatte, begab er sich auf die Landwirtschaftliche Hochschule in Berlin, die zur Immatrikulation kein Abitur verlangte. Er besuchte Vorlesungen in Wetterkunde, Botanik, Zoologie, Vererbungslehre und Experimentalphysik. Er dachte nicht unbedingt an einen geregelten Studiengang, sonst hätte er wohl Vorlesungen unter dem Gesichtspunkt eines späteren Examens gewählt.
An der Hochschule bekam er Kontakt mit der Burschenschaft Swebia, deren Burschen alle aus dem deutschnationalen und völkischen Lager kamen. Das Burschenschafterleben mit seinen Riten sprach Eggers indes wenig an. Wirkliche Freude hatte er nur am Fechten und war bald bei jeder Mensur gefürchtet. Um neben dem theoretischen Wissen auch die Praxis der Landwirtschaft kennenzulernen, arbeitete er für einige Zeit auch auf einem Gut in Mecklenburg und in der Niederlausitz als Volontärverwalter. Als die deutsche Regierung die im Versailler Diktat gestellten Forderungen nicht mehr erfüllen konnte, Frankreich das Ruhrgebiet besetzte und ein neuer Polen-Einfall in Schlesien zu befürchten war, hoffte Eggers, daß sich der von der Regierung ausgerufene passive Widerstand zur Mobilmachung der Armee weiterentwickeln würde und meldete sich in Frankfurt an der Oder bei der Reichswehr. Er wurde Kanonier in der 5. Batterie des 3. (preußischen) Feldartillerie-Regiments »Generalfeldzeugmeister«. Die bewußt entpolitisierte Reichswehr konnte aber den zum politischen und geistigen Aktivisten Gereiften, der leidenschaftlich an den politischen Gärungen seiner Zeit teilnahm, nicht halten. Als die erhoffte Mobilmachung ausblieb, gelang es Eggers, obwohl für 12 Jahre verpflichtet, seine vorzeitige Entlassung zu erwirken.
Der Drang zum Studium zog ihn nach Berlin zurück. Aber um nun richtig studieren zu können, war das Abitur vonnöten. Nach einigem Suchen fand er ein Gymnasium, das ihn als Oberprimaner aufnahm. Er wollte die Laufbahn eines Archäologen einschlagen und lernte nun neben Latein und Griechisch auch Hebräisch, da diese alte Sprache als Voraussetzung zu fruchtbringender Arbeit erschien. Eggers erhielt sein Reifezeugnis und galt als einseitig begabt, da er in Mathematik vollkommen versagt hatte.
Im Oktober 1927 ging er nach Rostock, belegte dort Vorlesungen in Sanskrit, Aramäisch, Philosophie, Archäologie und Theologie, um möglicherweise später als Archäologe mit Bibelkenntnissen zu habilitieren. In Rostock stattete Eggers dem Corps Vandalia einen Besuch ab. In dem in politischer Hinsicht als besonders radikal geltenden Corps fand er bald Aufnahme und machte auch hier seinem Ruf als gefürchteter Fechter bei den Mensuren alle Ehre. Einige Monate des Jahres 1929 verbrachte er in Berlin, um für seine Seminararbeit über den Kulturkampf Bismarcks mit der katholischen Kirche im Preußischen Geheimen Staatsarchiv Material zu sammeln. Eggers wollte über dieses Thema zum theologischen Doktor promoviert werden und darüber einen Band herausgeben, der Jahre später – 1935 – auch als sein Büchlein »Rom gegen Reich« erschien.
Reichsfeindliche Haltung des Zentrums
Im Archiv nahm man seine Arbeit wenig freundlich auf, da man der Meinung war, daß Aufdeckungen über die Vergangenheit und die Anfangskämpfe des Zentrums gegen das Reich und Bismarck nichts Gutes an sich hätten. Aber nach einigen Verhandlungen konnte er mit seiner Quellenarbeit beginnen und stellte mit Erschütterung fest, wie raffiniert und skrupellos das Zentrum gearbeitet hatte.
Mit List gelang es ihm auch, Einsicht in die verschlossenen »römischen Akten«, vor allem bestehend aus dem Briefwechsel des preußischen Gesandten mit dem Vatikan, zu erhalten. Als die Sachbearbeiter des Archivs hinter die Schliche von Eggers’ Treiben kamen, setzten sie ihn vor ihre Tür. Doch das Gelesene reichte ihm, um die Intrigen, Verrätereien und Verleumdungen der politisierenden Kirche in Gestalt von Pfaffen, Männern und Frauen im Solde Englands und Frankreichs, Beauftragten Habsburgs, selbst im deutschen Kaiserhaus, gegen Bismarcks Politik aufzudecken. Begeistert las Kurt Eggers in seiner studienfreien Zeit Geschichtsbücher über die Zeit der Reformation und Gegenreformation. Ob er über Melanchthon, Erasmus von Rotterdam, Sickingen oder Luther las – stets fand er auch zu Ulrich von Hutten. Mit der Zeit malte sich Eggers sein eigenes Huttenbild und der Reichsritter und Humanist wurde sein geistiger Schwertbruder. Dieser bedingungslose Freiheitskämpfer, mit Eggers seelenverwandt, wurde für ihn zum Vorbild, und Dr. Hans W. Hagen charakterisierte das Verhältnis von Eggers und Hutten treffend: »Wie jener verwarf er die Konfessionen um des Glaubens willen, die Länder und Stämme um des Reiches willen, die Stände um der Gesamtheit des Volkes willen.«
Im Rahmen des theologischen Seminars hielt Kurt Eggers an der Universitätskirche zu Rostock zur Jahreswende 1929/30 seine erste Predigt. Die üblichen Auslegungen des angeblichen Willen Gottes waren ihm zuwider. So war seine Predigt eine philosophische Abhandlung, die er auswendig lernte. Sein damaliges Verständnis des Christentums war noch nicht zu dem gereift, wie er es später sah, aber er fühlte sich auch zu dieser Zeit nicht als Mann, der das Wort Gottes sprechen sollte und zurück zu Christus ging.
Dort weiterbauen, wo Luther aufgehört hatte
Er wollte vielmehr dort weiterbauen, wo Luther aufgehört hatte. Die Kirche sollte der Sammelpunkt des geistigen und seelischen Standortes sein. Er suchte die letzte Klarheit und spürte die Unfreiheit und die Schranken in Bibel und Kirche. Das gesuchte Vorwärtsdrängen fand er nur, wenn er sich mit Hutten oder Nietzsche befaßte. Dort stieß er auf die Rücksichtslosigkeit im Freiheitsdrang, da entdeckte er Lachen, Freude und Frechheit. So sprach Kurt Eggers vor den anwesenden Gästen nicht von »Gott«, »Glaube« oder »Kirche«, sondern von Freiheit, Verantwortung, Opfer und Kampf. Sein Referat beendete er mit einem Aufruf zur Besinnung auf die Pflichten des Lebens.
Michael Collins
06:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Qui suis-je? Yukio Mishima !

Ce " Qui suis je ? " Mishima entend sortir des ornières du culturellement correct. Il étudie, dans sa " double voie ", celui qui se voulait de l'" autre race " - la race solaire opposée à la race lunaire. Il retrace son parcours existentiel, littéraire et métapolitique ; de la naissance au sacrifice exemplaire. En 1970, témoignant qu'il fut, selon ses propres équations, un rebelle total à la vision moderne du monde, Yukio Mishima se donnait la mort selon l'ancien rite samuraï du seppuku. Le geste souverain du plus grand écrivain de la littérature nippone d'après-guerre a beaucoup contribué à le faire connaître hors de son pays, tout en suscitant de multiples et contradictoires interprétations. Excellent connaisseur des littératures occidentales, notamment française, et auteur inclassable au sein de la littérature japonaise moderne,
| Broché: 127 pages - Editeur : Pardes (8 janvier 2007) - Collection : Qui suis-je ? - ISBN-10: 2867142318 - ISBN-13: 978-2867142314 |
06:00 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook