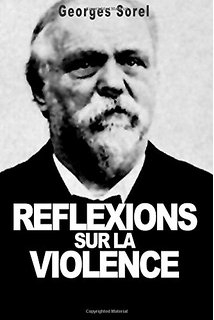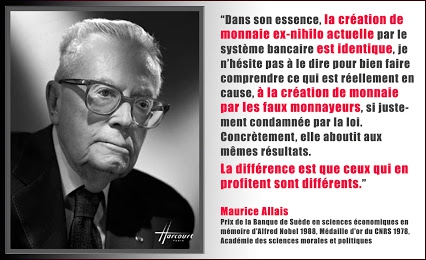Dazu trägt vor allem die Tatsache bei, dass sie in Auseinandersetzung mit der dekadenten Form einer bürgerlichen Demokratie entwickelt worden sind. Sorels Selbstverständnis war das eines syndikalistischen Revolutionärs (Marxist). Von Marx hatte er aber wenig mehr als die ökonomische Geschichtsauffassung und die Klassenkampftheorie übernommen. Als eifriger Schüler Henri Bergsons war er von dessen Lebensphilosophie beeinflusst. Von Vico übernahm er die Diagnose, dass die Gegenwart auf eine schwere historische Krise zusteuere und der Untergang mit der Überfeinerung der Sitten, der Verstandesbarbarei und der moralischen Entartung bereits angehoben habe. Durch seine strenge Sittlichkeit erweist sich Sorel als Geistesverwandten des Anarchisten des neunzehnten Jahrhunderts, Pierre-Joseph Proudhon.
Französisches Gegenstück zu Nietzsche
Als antiintellektueller Verächter der bürgerlichen Intelligenz war Sorels eigenes Dasein ein bürgerliches, er selbst in ausgezeichnetem Maß ein Intellektueller. Der Widerspruch löst sich auf, wenn man Sorel in die Nähe zu Nietzsche bringt. Es ist geradezu von einem „französischen Nietzscheanismus“ Sorels gesprochen worden. In seiner antibürgerlichen Gesinnung erscheint Sorel noch dazu als der lebendige Beweis für Nietzsches Aphorismus „Trost der Gefährdeten“ (Morgenröte, § 154): „Die Griechen, in einem Leben, welches großen Gefahren und Umstürzen sehr nahe stand, suchten im Nachdenken und Erkennen eine Art Sicherheit des Gefühls und letztes Refugium. Wir, in einem unvergleichlich sichreren Zustande, haben die Gefährlichkeit ins Nachdenken und Erkennen getragen und erholen und beruhigen uns von ihr im Leben.“
Diese „Gefährlichkeit des Denkens und Erkennens“ nimmt bei Sorel die Form eines Protests gegen ein Übermaß an Sicherheit und Wohlsein an. Sorels Reaktion steigert sich dabei zur Negation einer bürgerlichen Gesellschaft, die sich selbst negiert, d.h. die sich in falsche Sicherheiten gewogen hat.
Die Gesellschaft ist „aus den Fugen“
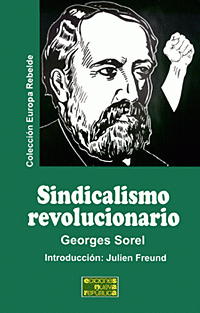 Sorels Einstehen für die Gewalt ergibt sich daraus, dass er den moralischen Zustand der bürgerlichen Gesellschaft haargenau getroffen hat: die bürgerliche Gesellschaft ist „aus den Fugen“. Der Bourgeois, ehemals ein energischer Kapitalist, ist zum schwächlichen Humanisten und Philanthropen degeneriert. Ihn zeichnen nicht mehr der Kampfgeist und der übersprühende Machtwille einer aufblühenden, sondern das Ruhebedürfnis und die Albernheit einer untergehenden Klasse aus: der Industriekapitän und der heroische Produzent von einst sind einer „gesittigten Aristokratie“ gewichen. Diese wünscht nur noch, in Frieden zu leben und sogar in Ruhe zu sterben.
Sorels Einstehen für die Gewalt ergibt sich daraus, dass er den moralischen Zustand der bürgerlichen Gesellschaft haargenau getroffen hat: die bürgerliche Gesellschaft ist „aus den Fugen“. Der Bourgeois, ehemals ein energischer Kapitalist, ist zum schwächlichen Humanisten und Philanthropen degeneriert. Ihn zeichnen nicht mehr der Kampfgeist und der übersprühende Machtwille einer aufblühenden, sondern das Ruhebedürfnis und die Albernheit einer untergehenden Klasse aus: der Industriekapitän und der heroische Produzent von einst sind einer „gesittigten Aristokratie“ gewichen. Diese wünscht nur noch, in Frieden zu leben und sogar in Ruhe zu sterben.
Die Gründe dieser Dekadenz liegen in einem Phänomen, welches Marx nicht vorhersehen konnte: die kapitalistischen Gesellschaften sind, im Gegensatz zu allem vorhergehenden, dermaßen reich, dass dieser unermessliche Reichtum dazu geführt hat, den Bourgeois zu verderben. Diesem fehlt nunmehr der Antrieb, seinen ureigensten Pflichten, dem Klasseninteresse, nachzukommen. Auch ist ihm das Klassenbewusstsein abhanden gekommen. Stattdessen treibt es ihn dazu, müßig humanitäre Überlegungen anzustellen. Die humanistisch-moralische Bildung seiner Zeit kommt dem sanftmütigen Bourgeois in seinen Spekulationen entgegen. Die Bildung liegt nämlich in den Händen einer schmarotzenden Intellektualität: Soziologen, Philosophieprofessoren, Juristen, Literaten. Diese Vertreter der „Klein-Wissenschaft“, d.h. der offiziellen Wissenschaft, haben keine Ahnung von der Wirklichkeit, sondern reproduzieren im eigenen Interesse nur die Dummheit der öffentlichen Meinung.
Die Indolenz der Bürger verdirbt auch die Sozialisten
Die Albernheit und Nichtigkeit dieser Spekulationen betont Sorel ohne Ende. Auch wird er nimmer müde, die Dummheit, Ignoranz und Eitelkeit der Moralapostel sowie der von ihnen Bedienten zu schelten. Im Grunde genommen sind es furchtsame Geschöpfe. Sie gehören einer demoralisierten Klasse an, die selbst wiederum auf ihre Gegner, die Sozialisten, demoralisierend wirkt. Diese sehen nämlich in der Geduld, mit der die Bourgeoisie Plünderungen über sich ergehen und sich von jedem, der dezidierter ist als sie, vereinnahmen lässt, eine Einladung zum Mitmachen: der Sozialismus hört auf, klassenkämpferisch zu sein. Als braver parlamentarischer Sozialismus kommt es ihm von jetzt ab nur noch darauf an, Vorteile für sich, für die Funktionäre, zu erhaschen, sowie die Bürger auszupressen.
Diese Umbildung des Sozialismus beinhaltet die Entdeckung der Tugend der Mäßigkeit: die Selbstdisziplin sowie die Beschränkung darauf, nur vernünftige Forderungen zu stellen. Dabei spielt eine entscheidende Rolle die bürgerliche Sozialpolitik. Diese dient der Lösung der „sozialen Frage“ im Sinne einer Friedenspolitik. Das Manko dabei ist, dass dieses Ruhmesblatt des demokratischen Parlamentarismus, der so großzügig zum Mitmachen eingeladen hat, der soziale Friede nämlich, im wahrsten Wortsinne ausgeklügelt, ausgehandelt und erkauft worden ist. Eigentlich eine Schmach für ein Bürgertum, das kapituliert hat. Und, noch näher betrachtet, bedeutet die Sozialpolitik eine große Verderbnis für das Proletariat: ihm ist die Chance genommen, revolutionär zu sein. Anstatt eines für eine Bewegung wesentlichen Aktivismus tritt die Paralyse der parlamentarischen Parteienlandschaft in Kraft.
Heuchelei und fehlendes Ehrgefühl bedienen sich der Moral
Dass jeder Frieden grundsätzlich zu jedem Preis erkauft werden sollte, koste er, was er wolle, ist eine törichte Albernheit. Nach Sorel ergötzen sich daran nur Wirrköpfe, wie die einer dem Tode geweihten Bourgeoisie. Dieser Verrat an der Sache erfasste jedoch auch die sozialistische Führung, die aus Anpassungsdrang die humanitären Ängstlichkeiten und Albernheiten der Bürgerlichen imitierte.
Auch hier wird die Parallele zu Nietzsche wieder deutlich: Nietzsche attestierte einen Mangel an Redlichkeit. Bei der Beurteilung dieser bürgerlichen Moral, sowie ihrer wahren Quellen, stimmen Sorel und Nietzsche ebenfalls überein: Nietzsches Aphorismus „Moral einer handeltreibenden Gesellschaft“ (Morgenröte § 174), wo die „vorgeschriebenen moralischen Handlungen der Sympathie“ auf einen „sozialen Trieb der Furchtsamkeit“ zurückgeführt werden, passt hervorragend zu Sorels Darstellung des „demokratischen Sumpfes“: auch hier verwischen sich die Konturen und kommt es zur friedensstiftenden Konfusion.
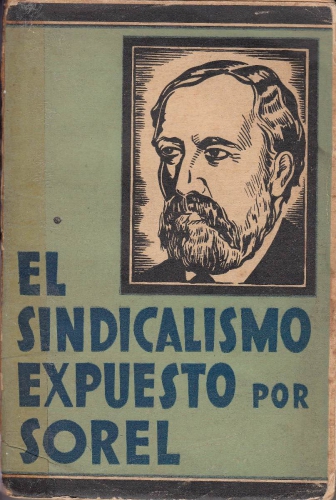 Nur Gewalt schafft Klarheit
Nur Gewalt schafft Klarheit
Aus dieser, der parlamentarischen Demokratie und bürgerlichen Gesellschaft gleichermaßen spezifischen Atmosphäre der Konfusion, gilt es, auszubrechen. Das einzige legitime Mittel der politischen Betätigung in ihr, das so auch von allen geübt wird, ist die Geschmeidigkeit der Verstellkunst: die Diplomatie. Diese ist bereits die aufgegangene Saat des Verderbens. Der Ausbruch aus dem parlamentarischen System hat deswegen auch mit dessen tragenden Pfeilern – Kalkül, Geschwätzigkeit, Gewaltverzichtsbekundungen – zu brechen, sowie mit allen Gepflogenheiten und Übereinkünften in Bezug auf die guten Manieren aufzuräumen.
Das geht aber nur im bewussten Gegensatz zum Staat, der nicht erobert, sondern zerstört werden muss. Diese „direkte Aktion“, die Sorel verkündet, erheischt dabei eine ganz andere Disziplin als die der Diplomatie: die Disziplin der Gewalt als eines „brutalen und klaren Ausdrucks des Klassenkampfes“ sowie als „reine und einfache Äußerung der Klassenkampfgesinnung“.
Sorel begreift die revolutionäre Gewalt als Kriegsmaßnahme. Es geht darum, Krieg gegen einen Feind zu führen – nicht, Rache zu üben oder sich der wilden Raserei hinzugeben. Charakteristisch antibürgerlich ist Sorels Hinweis, dass es bei dieser proletarischen Art gewalttätiger Gerechtigkeitsübung nicht darum geht, den Gegner zu kriminalisieren, wie es die Bürgerlichen für gewöhnlich tun. Sondern darum, dass dem Proletariat im Kampf gegen den Bourgeois moralische Tugenden erwachsen, die auch den Namen der Moral verdienen. Daraus könnte sogar die Bourgeoisie ihren Nutzen ziehen, dadurch, dass sie im Kampf zu ihrer alten Energie zurückfindet und so selbst wieder zu moralischer Höhe gelangt.
Mythos und „Erhabenheit“
Die revolutionäre Handlung, die Sorel vorschwebt, ist kein Erzeugnis von ihm verhassten Vernunfterwägungen, von kalten Kalküls und zweckmäßiger Anpassung. Sie steht im Zusammenhang mit der Mythenbildung. Ein Mythos ist für Sorel die Verbildlichung von Gruppenüberzeugungen. In dieser Eigenschaft ist er nicht zu analysieren, sondern einzig in Hinsicht auf seine Wirksamkeit zu beurteilen: ein Mythos, wie der „Generalstreik“, ist daher nicht einfach richtig oder falsch, sondern als Ausdruck einer Überzeugung entweder angemessen, d.h. wirksam, oder nicht.
Ein angemessener Mythos ist indiskutabel. Er kann nur anschaulich, als Ganzes erfasst und erlebt werden. In ihm erfahren die kämpfenden Gruppen den entscheidenden Antrieb zum Handeln sowie die moralisierende Wirkung von Vorstellungen des Erhabenen. Es sind Bilder der Entscheidungsschlacht und des Endkampfes, die das Gefühl des Erhabenen aufkommen lassen. In dieser Funktion, das Erhabene hervorzubringen und dem Kampf zu dienen, beschränken sich die Mythen auf die Tat. Nach ihrer Vollendung, darf diese aber nicht mit dem Mythos verglichen werden. Der Vergleich gäbe ihm Normcharakter, wie er jeder falsifizierbaren Utopie zukommt. Der Mythos aber ist nicht falsifizierbar, er ist, im Gegensatz zur Utopie, einfach nur Mittel zum Zweck.




 'Zelfvernietiging'
'Zelfvernietiging'
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg