|
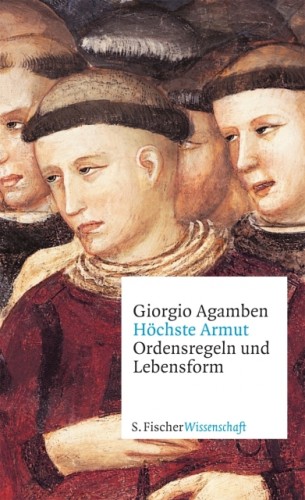 Das Verdikt über das Unverständliche ist die Rache des Bürgertums an Autoren, von denen, wenn sie einer Erkenntnis folgen, es immer nur jenen Zipfel zu greifen bekommt, der als reine Bedeutung explizit wird. Die fetischisierten Bedeutungen markieren am deutlichsten das bürgerliche Desinteresse an jeder Form von réalisation. Schon dass es Erkenntnisse gibt, ist des Bürgers Sache nicht. Sie stören die Wonne seines Meinens. Die Rache pflegt desto grausamer auszufallen, je bunter der Zipfel war, den der Autor preisgab, je „schillernder“, je mehr zum interessierten Gespräch Anlass gebend, zum Skandal taugend. Das Verdikt über das Unverständliche ist die Rache des Bürgertums an Autoren, von denen, wenn sie einer Erkenntnis folgen, es immer nur jenen Zipfel zu greifen bekommt, der als reine Bedeutung explizit wird. Die fetischisierten Bedeutungen markieren am deutlichsten das bürgerliche Desinteresse an jeder Form von réalisation. Schon dass es Erkenntnisse gibt, ist des Bürgers Sache nicht. Sie stören die Wonne seines Meinens. Die Rache pflegt desto grausamer auszufallen, je bunter der Zipfel war, den der Autor preisgab, je „schillernder“, je mehr zum interessierten Gespräch Anlass gebend, zum Skandal taugend.
Am wenigsten verzeiht der Bürger, dass das, was er liebt und wovon er lebt, das schier Augenscheinliche, sich letztlich doch ihm entzieht. Diese fundamentale Unsicherheit des Bürgers, Grund seiner zahlreichen „Nihilismen“, die in erster Linie nur der Rechtfertigung des Kitschs dienen, ist epochal geworden, keine phänomenologische Konstruktion von „Wesensgründen“ (die ihrerseits schon dem „Nihil“ aufruhen) hat daran etwas ändern können. Am Ende wird stets in Abrede gestellt werden, hinter dem erhaschten Zipfel habe je sich ein Kleid verborgen. Die beliebte Metapher des „Schillerns“ enthält sie bereits, diese Kritik. Alles kann in den Augen des Bürgers von jetzt auf gleich zu „schillern“ beginnen: Titel, Thesen, Begriffe, Charaktere, Gesten, Bedeutungen.
Die Existenz dessen aber, worauf das „Schillern“ verweist: der Autor wird sie sich allemal nur ausgedacht haben. Gewiss, er mag gut schreiben, die Lektüre stets „faszinierend“ sein. Unvorstellbar aber, dass er sich die Mühe gemacht hat, das zum Zipfel gehörige Kleid auch tatsächlich zu nähen. Seine Bücher: bloße Büchergesten, Intentionen ohne Realisierung, zum vielleicht größten Teil weiß er selbst nicht, was er eigentlich sagen, worauf er hinaus will. Der Autor ist und bleibt, was wir alle sind (und weshalb wir alle das Recht haben, kreativ zu sein und uns Gehör zu verschaffen): ein mehr oder weniger begabter Laberer. Agamben zumal, der raunende Philosoph, der italienische Sloterdijk: hangelt seine stilistisch gewiss bewundernswerte philosophische Belletristik sich nicht von bloßem Einfall zu bloßem Einfall, mit jedem weiteren Buch unfreiwillig den Blick des Lesers schärfend für die Maschen einer vergänglichen, da leeren und zwangsläufig sich selbst entzaubernden Verführungskraft?
„Dort, wo Gesten Worte werden, werden Worte Tatsachen.“ Herrschaft und Herrlichkeit (Homo sacer II.2)
Der Zipfel, mit dem der italienische Philosoph die gebildeten unter den deutschen Lesern zu verführen vermochte, ist bekannt: es war die These, das „Lager“ (Arbeits-, Straf-, Schutz-, Gefangenen-, Konzentrations-, Vernichtungslager) sei als biopolitischer Produzent des „bloßen Lebens“ das Paradigma der Moderne, und wir alle seien in einem mehr als nur symbolischen Sinne, nämlich wesenhaft, seine Insassen. Der Name, den Agamben seinem mehrteiligen Buchprojekt gegeben hat, Homo sacer, bezeichnete im römischen Recht ein Leben, das als heiliges zwar tötbar, aber nicht opferbar war. Es ist demzufolge das Heilige selbst, worin das nackte Leben, die tötbare Kreatur gerade als Gestalt der Profanität ihren Entstehungsgrund hat.
So erklärt sich Agambens Vorhaben, die These in einen großen religionsgeschichtlichen Zusammenhang zu stellen. Am Ende soll die Erkenntnis unabweisbar sein, was im Lager und als Lager sich manifestiere, sei kein inhaltlich bestimmter politischer Wille, sondern die Figur des Rechts als solche. Agamben schließt sich Benjamins radikaler Identifikation von Recht und Gewalt an. Hitlers rechtmäßiger Aufstieg zur Macht habe diese Identifikation nachträglich beglaubigt; der Ausnahmezustand, den Hitler ebenso rechtmäßig verkündete, sei als paradigmatische Figur des Rechts, welches den Ausnahmezustand allererst produziert, bis heute nicht beendet.
Das Zeitalter des Rechts aber: nach dem Willen Agambens vergeht es, in paulinischer Vergängnis. Das Recht zerstört sich in eben dem Maße, als es das Leben selbst zu seinem Gegenstand macht, das heißt: auf den Aspekt einer dirigierbaren Körperlichkeit reduziert, welche von ihm vernichtet wird, indem es vorgibt, sie zu erhalten. Was aber kommt, wenn das Zeitalter des Rechts (das in eins fällt mit der abendländischen Geschichte) endgültig vorbei ist? Wie wird sie aussehen, die „kommende Gemeinschaft“ dies-jenseits, jen-diesseits des Rechts und seiner Verpuppungen? Wie ist jene ursprüngliche Gerechtigkeit zu denken, die Agamben — darin freilich nicht originell — gegen die positiven Formen des Rechts ausspielt?
Diese Fragen sind so drängend, und Agamben beantwortet sie bislang so wenig konkret, dass jeder weitere Band des Homo sacer-Projekts von den Rezensenten im wesentlichen nur als „Überbau“ verstanden wird, welcher stets ein und dieselbe These, indem er sie mit historischem Material unterfüttert, zugleich verstellt und der Bewertung entzieht. Das wird sich auch mit dem vorliegenden Band IV,1 nicht ändern. Der Inhalt ist in seinen wesentlichen Zügen schnell zusammengefasst: anhand der Ordensregeln des mittelalterlichen Mönchtums entfaltet Agamben, der ausgiebig aus ihnen zitiert, die These, jenes „bloße Leben“, das in der Moderne in der Tatsache des Lagers seine unhintergehbare Faktizität gewann, habe historisch gesehen seinen Ursprung im „zönobitischen Projekt“ (25) des Mönchtums als dem Versuch, das Leben der Liturgie anzugleichen, die Liturgie im Leben dauerhaft zu machen.
Ergebnis dieses Versuchs sei ein „Leben, das mit seiner Form so innig verbunden ist, dass es von ihr nicht mehr unterschieden werden kann“ (9). „Was wird aus der Regel, wenn sie restlos mit dem Leben zu verschmelzen scheint? Und was aus einem Menschenleben, wenn es nicht mehr von der Regel zu unterscheiden ist?“ (17) Immer wieder wird in vorliegendem Buch diese Frage gestellt — so oft, dass oberflächliche Lektüre den Eindruck gewinnen mag, es komme Agamben im wesentlichen nur darauf an, die Frage zu stellen, nicht aber darauf, sie auch zu beantworten. Etwas „Drittes“ jedenfalls entstehe in der Zone der Verschmelzung, der Ununterscheidbarkeit von Regel (Gesetz) und Leben: etwas, das die untersuchten Texte unter den Syntagmen vita vel regula, regula et vita, forma vivendi, forma vitae „unermüdlich zu benennen suchen“ (123) und doch aufgrund der ungeheuren Neuheit dieser Entdeckung immer nur unzureichend benennen.
Es handelt sich eben um nichts geringeres als um die Entdeckung des „bloßen Lebens“ selbst in seiner nackten irreduziblen Faktizität. Dessen Eintreten ins menschliche Bewusstsein ist, so Agamben, die Folge davon, dass das zönobitische Projekt ein von Anbeginn utopisches gewesen ist. Die Angleichung des Lebens ans Gesetz konnte nicht mit der Unmöglichkeit dieses Unterfangens rechnen — einer Unmöglichkeit, die, als sie sich faktisch bereits erwiesen hatte, zudem nicht sogleich zu Bewusstsein kommen konnte aufgrund der alles bestimmenden Vorherrschaft der Liturgie. „Der Liturgisierung des Lebens entspricht eine integrale Verlebendigung der Liturgie.“ (160) Ergebnis aber sei ein zunächst sich selbst nicht begreifendes, auf nichts als die eigene Autonomie verwiesenes Leben, das sich durch seine „radikale Fremdheit“ (164) nicht nur gegenüber der Liturgie, sondern gegenüber schlechthin allen Formen des Rechts auszeichne.
Die Jahrhunderte sind der Prozess dieses Sich-selbst-begreifens. Es handelt sich für Agamben um eine „neue Konsistenzebene menschlicher Erfahrung“, die gegenüber der Liturgie, als die sie zunächst fälschlich sich begreift, „eine andere, noch unbestimmte Dimension des Seins und des Handelns erahnen lässt“ (122f.). Indes habe es einen in seiner Radikalität noch uneingeholten Vorstoß gegeben, an den gerade heute, im Zeitalter des Verendens des Rechts zu erinnern sei: den franziskanischen. In der franziskanischen Novitas erweist sich die fundamentale „Nichtanwendbarkeit des Rechts auf das mönchische Leben“ (48), das von Agamben geradezu definiert wird als Ideal einer „totalen Mobilmachung des Daseins durch die Zeit“ (41). Das „Leben“, an sich Gegenstand einer unbewussten Freisetzung, die erst nachträglich sich konstruieren lässt — die „alles entscheidende Frage“ (133) nach seiner Möglichkeit und Wirklichkeit ist bereits im Mittelalter von den Franziskanern gestellt worden. Für sie ging es nicht länger darum, „auf das Leben eine Form — oder eine Norm — anzuwenden, sondern darum, gemäß jener Form zu leben, d. h. um ein Leben, das sich in der Nachfolge selbst Form gibt, mit ihr zusammenfällt“ (137f.).
Es kann keine Rede davon sein, dass Agamben seine Thesen in Auseinandersetzung mit den historischen Quellen gewonnen hat. Die Quellen sind herbeigesucht, um die vorgängige Konstruktion der Thesen zu stützen. Für illegitim kann dies nur halten, wer nicht begreift, worum es Agamben in jedem seiner Bücher geht. Der Sinn seiner Konstruktionen ist die eschatologische Unwirksammachung der Tradition am Ende ihres Laufs, am Ende der Geschichte, am Ende aller Zeitalter. Das „Kommende“, der Zustand dies-jenseits, jen-diesseits des Rechts — das unterscheidet Agambens Vision allemal von der kommunistischen Utopie — wird kein aktiv zu ergreifendes, planhaft anthropotechnisch zu realisierendes historisch-epochales Geschick mehr sein, sondern das Ausmünden der Geschichte selbst in den Stand der eschatologischen Indifferenz.
Einzig so erklärt sich die Identifikation mit dem franziskanischen Spiritualismus und der ihm wesentlichen Unterscheidung von Eigentum und Gebrauch. Die naturrechtliche Lehre von der ursprünglichen Gütergemeinschaft ist der rechtsgeschichtliche Hintergrund, nicht aber ein zu reaktivierender Sinn der Unterscheidung. Denn Agamben zufolge geht es einzig „um die Möglichkeit, als Mensch außerhalb des Rechts zu existieren“ (151). Die franziskanische Novitas besteht in dem „Versuch, ein den Bestimmungen des Rechts völlig entzogenes menschliches Leben und Handeln zu verwirklichen“ (152).
Wenn Agamben diesen Versuch eine „noch immer ungedachte und im gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft völlig undenkbare Neuheit“ nennt (152), so sind wir im Zentrum seiner geschichtsphilosophischen „Konstruktion der Gegenwart“ angelangt. Die Beschäftigung mit den Ordensregeln und der Lebensform des christlichen Mönchtums erweist sich als die Nahtstelle, wo am historischen Ursprung der Kategorie des „bloßen Lebens“ zugleich dessen erkenntnistheoretische Konfiguration kenntlich werden muss. Wird sie es? Die diesbezüglich zentrale Feststellung lautet: „Der Konflikt mit dem Recht — oder besser der Versuch, es durch den Gebrauch außer Kraft zu setzen und unwirksam zu machen — ist auf derselben existentiellen Ebene angesiedelt, auf der sich auch die Operativität des Rechts und der Liturgie entfaltet. Die Lebensform ist jenes reine Existenzial, das es von den Signaturen des Rechts und des Offiziums zu befreien gilt.“ (185)
Der Anspruch der Spiritualen habe zwar darin bestanden, „dass der Gebrauch nicht nur negativ im Verhältnis zum Recht definiert wird [...], sondern einen eigenen formalen Grund hat und in einer objektiv bestimmten Operation endet.“ (173) Faktisch aber habe die „Hartnäckigkeit, mit der die franziskanischen Theoretiker den Verzicht auf das Recht mit rechtlichen Begriffen zu formulieren versuchten“ (155), die Einlösung dieses Anspruchs verhindert. Für Agamben hängt also, wie mit diesem letzten Argument deutlich wird, die Herrschaft des Rechts an einer vorgängigen und auszuschaltenden Herrschaft der Sprache des Rechts, so wie für Heidegger die Herrschaft der Metaphysik an einer vorgängigen und auszuschaltenden Herrschaft der Sprache der Metaphysik hing. Das ist mehr als eine Analogie. Agamben und Heidegger operieren, wie in der Rede vom „reinen Existenzial“ deutlich wird, auf dem Boden ein und derselben erkenntnistheoretischen Konfiguration. Dieses Fundament ist schwach, ja hinfällig. Gegen es aufzubieten ist mit Scholem die Einsicht, dass „das absolut Konkrete [...] das Unvollziehbare schlechthin“ ist, und dass es sich bei der messianischen Idee, die Agambens Vision im verborgenen leitet, um „die eigentlich anti-existentialistische Idee“ handelt.
Damit ist die Tiefenschicht bezeichnet, in der Agambens Homo sacer-Projekt und Esoterik der Schrift konvergieren. In Tradition und Transzendenz ist dargestellt, dass die Heideggers Spätwerk bestimmende Kategorie einer „Überwindung“ der abendländischen Metaphysik einen Rückfall in die existenzphilosophischen Bestimmungen des Frühwerks darstellt, der seinen Grund im vorzeitigen Abbruch des Denkwegs der „Kehre“ hat. Denn gerade sie hätte Heidegger das Instrument an die Hand gegeben, die Begriffe der Metaphysik als Figuren dessen zu gewahren, was an ihnen —chôra der platonischen Idee — nicht metaphysisch ist. Analog wäre auch die Rede von einem „Gebrauch des Rechts“ auf den Ort der von Agamben selbst proklamierten eschatologischen Indifferenz hin zu modifizieren.
Die Logik der „Überwindung“ unterbietet ihn. Es gibt keine Sprache jenseits des Rechts, sondern der Grad ist zu bestimmen, in dem das Recht der Sprache immanent ist, um das Recht als sprachloses sich in der Stummheit seiner Gewalt verschließen zu lassen. Das wäre das Wahrheitsmoment der spiritualistischen Revolte, an die keine bürgerliche Kritik von Agambens Werk hinanreicht. Für Scholem und Benjamin konzentrierte es sich im Begriff der Schrift, den sie anlässlich von Kafkas Parabel Vor dem Gesetz diskutierten. Giorgio Agambens Interpretation dieser Diskussion (Homo sacer I, 60ff.) enthält alle Elemente seiner Verfehlung dieses Begriffs. Gerade in dieser Verfehlung aber ist Agamben ernst zu nehmen. Sie konstituiert die Intensität seiner Geste, den Keil des bloßen Lebens in das Herz der Tradition zu schleudern. Sie ist nahe daran, Wort zu werden.
Giorgio Agamben: Höchste Armut. Ordensregeln und Lebensform (Homo sacer IV,1). Aus dem Italienischen von Andreas Hiepko. S. Fischer (Frankfurt am Main) 2012. 208 Seiten. ISBN 978-3-10-000533-5.
Zuerst erschienen auf: http://timokoelling.wordpress.com/rezensionen/giorgio-agamben-hochste-armut/
Die Redaktion bedankt sich bei Timo Kölling für die Erlaubnis zur Übernahme dieses Beitrags.
|
 |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




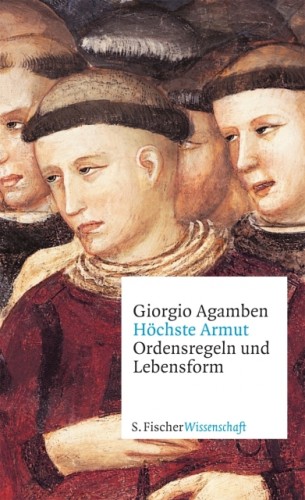 Das Verdikt über das Unverständliche ist die Rache des Bürgertums an Autoren, von denen, wenn sie einer Erkenntnis folgen, es immer nur jenen Zipfel zu greifen bekommt, der als reine Bedeutung explizit wird. Die fetischisierten Bedeutungen markieren am deutlichsten das bürgerliche Desinteresse an jeder Form von réalisation. Schon dass es Erkenntnisse gibt, ist des Bürgers Sache nicht. Sie stören die Wonne seines Meinens. Die Rache pflegt desto grausamer auszufallen, je bunter der Zipfel war, den der Autor preisgab, je „schillernder“, je mehr zum interessierten Gespräch Anlass gebend, zum Skandal taugend.
Das Verdikt über das Unverständliche ist die Rache des Bürgertums an Autoren, von denen, wenn sie einer Erkenntnis folgen, es immer nur jenen Zipfel zu greifen bekommt, der als reine Bedeutung explizit wird. Die fetischisierten Bedeutungen markieren am deutlichsten das bürgerliche Desinteresse an jeder Form von réalisation. Schon dass es Erkenntnisse gibt, ist des Bürgers Sache nicht. Sie stören die Wonne seines Meinens. Die Rache pflegt desto grausamer auszufallen, je bunter der Zipfel war, den der Autor preisgab, je „schillernder“, je mehr zum interessierten Gespräch Anlass gebend, zum Skandal taugend.
Les commentaires sont fermés.