En janvier dernier, le virologue David Evans et son équipe de l’université d’Alberta, au Canada, indiquaient, dans la revue PLoS One, qu’ils avaient réussi à produire, à petit budget, une variante du virus de la variole. Conçue sur la base de séquences d’ADN trouvées sur Internet – qui provenaient du virus responsable de la forme chevaline de la variole –, l’initiative visait à produire un vaccin plus efficace contre cette maladie. Six mois plus tôt, la revue Science mettait déjà en garde contre cette recherche, alors en cours, qui pouvait donner l’occasion à des terroristes de produire à peu de frais des armes biologiques.
De fait, depuis que la période de l’après-Guerre froide a sonné le glas de la bipolarité politique du monde, ce que l’on nomme aujourd’hui le bioterrorisme préoccupe les États, particulièrement depuis l’épisode dit des « lettres à l’anthrax », au cours duquel, en octobre 2001, diverses institutions, dont des rédactions de journaux, avaient reçu des lettres contenant des bacilles de la maladie du charbon.
Certes, dès les premières décennies du xxe siècle, les États qui en avaient les capacités s’étaient lancés dans une course aux armements biologique et chimique, mais de nos jours, un nouvel aspect est venu renforcer l’inquiétude des dirigeants à ce sujet : la crainte de voir émerger des capacités de destruction sortant du cadre étatique. Le très grand nombre de canulars et les tentatives avérées de bioterrorisme des trente dernières années – dont celles des sectes Rajneesh à The Dalles, dans l’Oregon, en 1984 et Aum à Kameido, au Japon, en 1993 –, conjointement avec la fin de la Guerre froide et l’avènement d’Internet, laissent penser que l’arme biologique, l’arme atomique du pauvre comme la surnomment souvent les militaires, représenterait une menace sans précédent.
Le fait qu’une revue scientifique alerte sur les risques bioterroristes liés à une étude montre que le monde scientifique a fait siennes ces craintes. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Si dès les années 1950, profondément marqués par l’emploi de la bombe atomique, les physiciens du domaine ont pris acte des enjeux éthiques et politiques de leurs recherches, pendant ce temps, les chimistes, biologistes et médecins concernés par l’usage militaire de leurs travaux ne dénonçaient que marginalement les recherches sur les armes biologiques et chimiques, sans doute à cause de leur caractère plus secret et des usages moins catastrophiques ou spectaculaires qui en étaient faits.
Pourtant, ces armes ont été développées et utilisées dès le début du xxe siècle, soit bien avant l’arme nucléaire, et ce grâce à l’expertise scientifique et médicale de nombre d’entre eux. Un minutieux travail de recherche dans les archives militaires françaises, mais aussi dans d’autres fonds comme les archives de la direction de l’institut Pasteur, nous a en effet récemment permis de montrer que, en France, ces armes ont fait l’objet d’une collaboration continue des militaires avec des scientifiques et médecins civils, membres d’institutions de premier plan.
Du roquefort aux nuages artificiels
 La France a été pionnière dans le domaine des armes biologiques et chimiques. Dès la première décennie du XXe siècle, un chimiste français renommé, Auguste Trillat, inventeur du formol quelques années auparavant, brevetait certes un procédé de fabrication industrielle du roquefort, mais posait aussi les bases de la production intentionnelle d’épidémies à l’aide de nuages artificiels microbiens.
La France a été pionnière dans le domaine des armes biologiques et chimiques. Dès la première décennie du XXe siècle, un chimiste français renommé, Auguste Trillat, inventeur du formol quelques années auparavant, brevetait certes un procédé de fabrication industrielle du roquefort, mais posait aussi les bases de la production intentionnelle d’épidémies à l’aide de nuages artificiels microbiens.
Bien avant la Première Guerre mondiale, le pays avait entrepris des recherches à visée militaire sur les armes chimiques. Mais c’est pendant cette guerre que les Français, puis les Allemands, firent pour la première fois usage de gaz de combat. Les armes dites biologiques furent elles aussi utilisées, mais de façon marginale, plutôt en tant que moyens de sabotage (pour tuer du bétail ou des animaux de transport) qu’en tant qu’armes de destruction massive, ou visant massivement les humains. Néanmoins, la menace de guerre bactériologique que ces attaques rendaient plus tangible fit avancer les recherches sur les méthodes de désinfection et de prophylaxie (l’ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies). Trillat, devenu en 1905 chef du service des recherches appliquées à l’hygiène de l’institut Pasteur, à Paris, joua ainsi un rôle fondamental dans la création du programme français d’armement biologique et chimique après la Première Guerre mondiale.
En 1922, lui qui avait été pionnier tant dans la production de nuages artificiels déclencheurs d’épidémies, pour lesquelles il avait étudié les conditions atmosphériques propices à leur développement, que dans la recherche de méthodes de désinfection chimique à grande échelle, fut sollicité pour donner les lignes directrices de ce nouveau programme, sous la forme d’un rapport commandé l’année précédente par le ministère de la Guerre. Dès lors s’installa une collaboration continue entre institutions de recherche civiles et militaires. Les recherches sur les armes chimiques et biologiques requérant des compétences et des équipements similaires, les institutions et chercheurs mobilisés travaillaient en commun sur les deux systèmes, qu’il s’agisse de la recherche, du développement ou de la production.
L’institut Pasteur, ainsi que de nombreuses institutions scientifiques et médicales françaises de premier plan, dont le Muséum national d’histoire naturelle et le Collège de France, participèrent à ce programme par l’intermédiaire de certains de leurs membres éminents, comme les chimistes Charles Moureu (Collège de France), Marcel Delépine (faculté de pharmacie) et André Job (Conservatoire national des arts et métiers), travaillant sous contrats secrets avec la sphère militaire.
Dans le monde, la crainte que les guerres du futur voient s’amplifier le caractère de guerre totale qu’avait pris la Grande Guerre conduisit les principales nations occidentales, mais aussi le Japon, à préparer en temps de paix, dès l’entre-deux-guerres, les moyens de défendre – et d’attaquer – non plus seulement les combattants, mais les populations de nations entières. À cette même époque, des rumeurs issues de la presse britannique sur des essais secrets de dispersion d’agents biologiques effectués par des agents secrets allemands dans le métro parisien achevèrent de convaincre l’opinion publique et l’État français de la nécessité de prendre au sérieux cette menace. La réorganisation de la France en nation armée, souhaitée au plus haut niveau de l’État, conduisit à la production de moyens offensifs et défensifs de guerre chimique, biologique, puis, après la Seconde Guerre mondiale, nucléaire.

L’activité secrète de la poudrerie du Bouchet
La poudrerie du Bouchet, à Vert-le-Petit, au sud de Paris dans l’actuelle Essonne, devint graduellement le centre névralgique d’un réseau de recherche et développement d’armes biologiques et chimiques, incluant d’autres institutions civiles et militaires. Elle demeure de nos jours, sous le nom de Centre d’études du Bouchet, le centre du ministère des Armées dédié à la défense contre les menaces biologiques et chimiques, et l’un des rares sites en France (et dans le monde) à disposer d’un laboratoire de niveau de sécurité P4. Peu à peu, la France rassembla ainsi secrètement, sous l’appellation d’armes spéciales, un arsenal de nouveaux moyens offensifs et défensifs, étudiés et développés avec l’apport constant de l’expertise scientifique et médicale civile.
En 1947, une Commission médicale de défense contre la guerre moderne vit le jour afin de mieux centraliser les études relatives aux armes spéciales, de reconstruire une défense nationale incluant ces armes et de tirer parti des recherches scientifiques civiles ainsi que des renseignements issus des réseaux scientifiques internationaux de chercheurs. Mixte, cette commission était composée de militaires et de savants de premier plan, pour beaucoup médecins des facultés de médecine ou chercheurs de l’institut Pasteur. Entre autres membres, Léon Binet, doyen de la faculté de médecine de Paris, Robert Debré, président de l’Institut national d’hygiène, ou Jacques Tréfouël, directeur de l’institut Pasteur, prenaient part aux discussions secrètes de la commission et répondaient secrètement à diverses commandes militaires. Les laboratoires civils entreprirent ainsi une grande diversité d’études sur, par exemple, le mode d’action des trilons (les gaz neurotoxiques Sarin, Tabun et Soman), la possibilité de vacciner contre la radioactivité ou encore celle de potentialiser les effets délétères d’aérosols de bacilles du charbon en les combinant avec des métaux lourds.
Les décennies suivantes, l’ouverture à la sphère civile des recherches sur les armes spéciales se referma partiellement, le gouvernement préférant concentrer ses forces sur l’arme nucléaire. Mais de nombreux chercheurs continuèrent de travailler sur financement militaire, à des fins prophylactiques ou non, leur expertise demeurant indispensable, s’agissant par exemple des études sur la polyvaccination. À titre indicatif, en 1967, le nombre d’animaux de laboratoire destinés en France à l’expérimentation d’agents chimiques et biologiques de guerre (20 000 souris, 20 000 rats, 5 000 cobayes, 2 000 lapins et 50 singes) représentait 10 % de l’utilisation actuelle par an d’animaux à des fins scientifiques.
Outre la motivation patriotique mise en avant par certains scientifiques pour justifier leur collaboration à ces programmes, la relation mutuellement bénéficiaire entre l’armée et les hommes de science en France explique sa pérennité. Ainsi, en 1972, Jacques Monod, alors directeur de l’institut Pasteur, écrivait au ministre de la Défense nationale Michel Debré qu’il serait souhaitable de renforcer et formaliser les liens entre l’armée et l’institut Pasteur, qui formait alors selon lui « la quasi-totalité des médecins-biologistes de l’armée ».
Des essais mystérieux en Algérie
Les armes testées au moins depuis les années 1930 à l’ouest du Sahara algérien (ainsi que dans certains centres d’expérimentation métropolitains, notamment près de Bourges) continuèrent de l’être jusqu’à la fin des années 1970. Notamment, on fit exploser des obus, roquettes et grenades chargés en agents biologiques ou chimiques pour mesurer leurs effets en situation réelle. La nature exacte et l’étendue des essais effectués secrètement en Algérie dans les deux décennies qui suivirent les accords d’Évian (1962) demeurent à ce jour peu connues et font donc régulièrement l’objet de spéculations légitimes de la part des populations concernées, craignant que les sites n’aient pas été parfaitement dépollués. Néanmoins ces essais ont eu lieu et ont participé de l’expertise française dans le domaine des armes chimiques et biologiques.
Ainsi, de l’aube du xxe siècle au début des années 1970, la France a développé et produit, à des échelles variables selon les époques et les priorités politico-militaires, des poisons synthétiques ou non, destinés, d’une part, à être utilisés en temps de guerre contre les hommes, les animaux et les plantes, mais aussi, d’autre part, à tester leurs effets à grande échelle pour mieux s’en prémunir en situation opérationnelle.
Les autres nations développées n’ont pas été en reste au cours du xxe siècle. Le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis, l’URSS, le Canada, les Pays-Bas, Israël, l’Afrique du Sud et d’autres ont aussi eu, à des fins diverses et des échelles variables, leur programme de guerre biologique et chimique. Le Japon, lorsqu’il occupait la Mandchourie avant la Seconde Guerre mondiale, a par exemple effectué de cruels essais sur les populations chinoises locales. Les États-Unis ont, à l’issue de cette guerre, secrètement récupéré les données que les Japonais avaient récoltées. Et, dans le cadre de la Guerre froide, l’URSS serait aussi entrée en lice avec son ambitieux programme Biopreparat, selon des transfuges russes tels que Ken Alibek ou Vladimir Pasechnik.
Parmi les scientifiques, mais aussi les militaires, il semble qu’un consensus ait perduré quant à la nécessité de maintenir une forme de politique de santé publique secrète pour défendre les populations contre les armes biologiques et chimiques. En France comme ailleurs, cependant, cette dimension avouable de leur action était contrebalancée par une contribution simultanée à des programmes souvent offensifs. Cette forme de politique de « santé publique inversée » – selon l’expression d’un de ses critiques de la fin des années 1960, le Britannique Robin Clarke – a placé les scientifiques et médecins devant un dilemme moral : collaborer secrètement avec les armées de leur pays pour prémunir des populations civiles contre des épidémies intentionnelles, au risque de contribuer en même temps à les doter de moyens offensifs en pratiquant des recherches non divulguées sur des agents pathogènes naturels ou synthétiques. Il semblait ainsi irresponsable de refuser cette collaboration autant qu’il l’était de l’accepter, et tout aussi irresponsable de publier les résultats des recherches comme de ne pas les publier. La réponse récurrente des scientifiques à ce dilemme, en France au moins, a majoritairement consisté à jouer le jeu du secret.
 De même, rares ont été les avocats de l’usage des sciences biomédicales pour la guerre. Si quelques scientifiques comme le généticien britannique John Burdon Sanderson Haldane (photo), dans les années 1920, ou des militaires tels que le brigadier général Jacquard Hirshorn Rothschild, après la Seconde Guerre mondiale, ont entrevu dans l’utilisation des connaissances en physiologie un moyen de rendre la guerre plus humaine (en introduisant la possibilité d’utiliser des agents non létaux plutôt que des armes conventionnelles aux effets moins prévisibles, comme les explosifs), la sélection précise des effets physiologiques des armes est demeurée une inclusion contre-nature de la science et de la médecine dans la guerre (tandis que des armes conventionnelles aux effets moins prévisibles sont restées autorisées).
De même, rares ont été les avocats de l’usage des sciences biomédicales pour la guerre. Si quelques scientifiques comme le généticien britannique John Burdon Sanderson Haldane (photo), dans les années 1920, ou des militaires tels que le brigadier général Jacquard Hirshorn Rothschild, après la Seconde Guerre mondiale, ont entrevu dans l’utilisation des connaissances en physiologie un moyen de rendre la guerre plus humaine (en introduisant la possibilité d’utiliser des agents non létaux plutôt que des armes conventionnelles aux effets moins prévisibles, comme les explosifs), la sélection précise des effets physiologiques des armes est demeurée une inclusion contre-nature de la science et de la médecine dans la guerre (tandis que des armes conventionnelles aux effets moins prévisibles sont restées autorisées).
Aujourd’hui, les armes biologiques et chimiques continuent de faire l’objet d’un dilemme moral récurrent pour la biomédecine. On ne s’improvise pas savant militaire : les chercheurs se lancent rarement dans une carrière médicale ou scientifique en vue de produire des systèmes d’arme ou de prémunir les populations nationalescontre des armes biologiques et chimiques. Aussi la sphère militaire a-t-elle toujours besoin de l’expertise de chercheurs civils et continue-t-elle, selon les périodes, à les inclure secrètement dans des programmes militaires ou à financer des travaux d’intérêt militaire.
La responsabilité des chercheurs civils est d’autant plus grande que sans expertise physiologique, la distinction entre les agents chimiques ou biologiques bénins et malins est impossible. La connaissance précise du fonctionnement du corps (humain, mais aussi d’autres animaux ou de végétaux) et de ses interactions avec des substances ou agents exogènes est essentielle pour caractériser une substance ou un agent comme un poison. À tel point que les armes biologiques et chimiques devraient être rassemblées sous un même terme, « armes physiologiques », qui insisterait plus sur la sélectivité de leurs effets que sur le moyen utilisé pour les obtenir.
Et demain ?
Sauf à adopter une anthropologie optimiste fondée sur une confiance universelle, il semble difficilement pensable qu’un État soucieux de la sécurité de sa population et du droit humanitaire international ne cherche pas à mobiliser ses scientifiques en vue de secrètement préparer sa défense, donc en effectuant des recherches sur un maximum d’agents malins et sur leurs antidotes. Il résulte de cette tension entre la vocation universaliste de la science et les circonstances politiques qu’il reste difficile de nos jours de distinguer les recherches à vocation défensive de celles à vocation offensive : se défendre contre des poisons implique en effet d’en disposer afin de trouver des antidotes. Et par conséquent d’anticiper les menaces en maintenant une recherche biomédicale et militaire de pointe. Si le cadre législatif international tend à préserver un statu quo entre les États, comme c’est le cas de la dissuasion nucléaire, le cadre géopolitique de l’après-Guerre froide tend quant à lui à laisser planer la menace d’une utilisation moins prévisible ou identifiable de ces armes empoisonnantes par des groupes privés ou non étatiques.
Cela d’autant que les avancées scientifiques et techniques des dernières décennies – notamment Internet, les nanotechnologies et l’utilisation des big data en médecine – sont susceptibles de conférer à des États comme à des entités privées des moyens de guerre biologique sans précédent, en accroissant la possibilité de sélectionner précisément les effets physiologiques ainsi que les éventuelles populations cibles.
Par exemple, nombre d’hôpitaux sont aujourd’hui dotés de biobanques où sont stockées et parfois partagées à grande échelle les données de patients consentants (notamment génétiques) et leurs échantillons biomédicaux. Ces biobanques constituent une avancée considérable pour la recherche biomédicale. Néanmoins, elles présentent aussi le risque qu’à la faveur d’une instabilité politique d’un État y ayant accès ou d’une privatisation de leur gestion (que l’OCDE préconise depuis 2001), le rêve d’un partage global des progrès de la biomédecine ne se transforme en un cauchemar militaro-industriel. Il est donc plus que jamais nécessaire que les citoyens s’emparent de la question de la guerre biologique, dont les enjeux relèvent tant de la sécurité militaire que des sécurités sanitaire et alimentaire.

Armes chimiques et armes « bio »
Aujourd’hui, la terminologie militaire établit une distinction entre les armes chimiques et les armes biologiques, fondée sur les substances utilisées. Cette distinction à des visées juridiques et tactiques. Les deux types d’armes ne sont pas interdits de la même manière ni depuis la même époque, et leur usage diffère. Pourtant, ils n’ont pas toujours été dissociés.
Parmi les textes de loi emblématiques à ce sujet, au milieu du xixe siècle, pendant la guerre de Sécession, fut adopté le code Lieber (1863) qui interdit, entre autres pratiques cruelles, l’usage de poisons dans la guerre. Mais à l’issue de la Première Guerre mondiale, une légère nuance est apparue dans le Protocole de Genève (1925) : il spécifia qu’il était interdit d’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et des moyens bactériologiques. Cette dissociation juridique en germe devint effective dans la seconde moitié du XXe siècle, avec la signature en 1972 de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Les armes chimiques sont ainsi demeurées sans interdiction spécifique autre que celle du Protocole de Genève jusqu’en 1993, lorsque la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’usage des armes chimiques et sur leur destruction fut adoptée.
Qu’est-ce qui distingue fondamentalement ces deux types d’armes ? Les toxines biologiques (la ricine, par exemple) étant fonctionnellement équivalentes à des armes chimiques, la distinction juridique est faite en vertu de leur origine. Les toxines biologiques sont ainsi qualifiées de biologiques en ce qu’elles ne sont pas des produits de la synthèse chimique, mais sont trouvées telles quelles dans la nature. Elles sont issues du vivant. Il en est de même des autres agents biologiques : bactéries, virus, champignons, et autres agents pathogènes non synthétiques sont inclus dans la catégorie des armes de guerre biologique. D’un point de vue juridique, les armes biologiques sont donc comparables… aux produits alimentaires dits « issus de l’agriculture biologique ». En revanche, toute reproduction de toxine biologique par chimie de synthèse relève du droit des armes chimiques…
Ainsi, la subdivision juridique des poisons prévus pour un usage guerrier est discutable à bien des égards. Elle a vraisemblablement eu pour fonction de permettre aux États concernés, dans la seconde moitié du XXe siècle, de poursuivre des recherches, développements et productions d’armes chimiques en toute liberté.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg





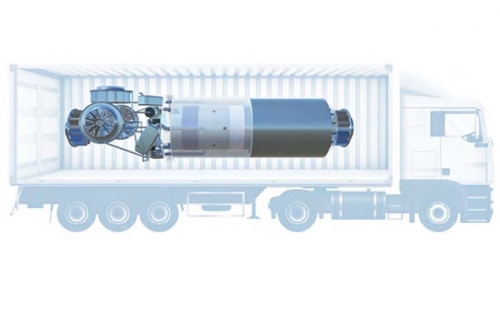



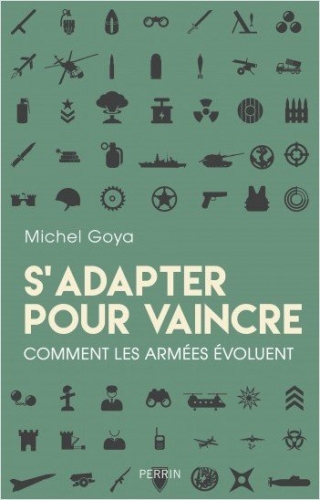
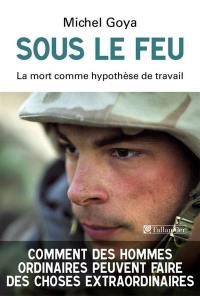 En prenant sept cas d’école de la conduite du changement dans les armées, Michel Goya propose ainsi avec S’adapter pour vaincre une analyse des rouages de l’adaptation des grandes structures militaires sous la pression de leur époque : qu’il s’agisse de l’ascension de l’armée prussienne au XIXe siècle, de la métamorphose de l’armée française durant la Première Guerre mondiale, du déclin de la Royal Navy au cours de la première moitié du XXe siècle ou encore de la confrontation de l’US Army avec la guerre moderne à partir de 1945, l’animateur du blog La Voie de l’épée met à chaque fois en lumière les inducteurs de la mue de la Pratique (avec un grand « P » sous la plume de l’auteur) au sein de ces organisations complexes. Car, pour Michel Goya, « faire évoluer une armée, c’est faire évoluer sa Pratique », cette même Pratique étant « le point de départ et d’arrivée du cycle de l’évolution ».
En prenant sept cas d’école de la conduite du changement dans les armées, Michel Goya propose ainsi avec S’adapter pour vaincre une analyse des rouages de l’adaptation des grandes structures militaires sous la pression de leur époque : qu’il s’agisse de l’ascension de l’armée prussienne au XIXe siècle, de la métamorphose de l’armée française durant la Première Guerre mondiale, du déclin de la Royal Navy au cours de la première moitié du XXe siècle ou encore de la confrontation de l’US Army avec la guerre moderne à partir de 1945, l’animateur du blog La Voie de l’épée met à chaque fois en lumière les inducteurs de la mue de la Pratique (avec un grand « P » sous la plume de l’auteur) au sein de ces organisations complexes. Car, pour Michel Goya, « faire évoluer une armée, c’est faire évoluer sa Pratique », cette même Pratique étant « le point de départ et d’arrivée du cycle de l’évolution ». Au-delà de la rétrospective historique, le principal intérêt de l’ouvrage est ainsi l’analyse percutante que livre Michel Goya sur les conditions d’apparition de cette innovation au sein d’une structure militaire. S’adapter pour vaincre montre comment les innovations de rupture ne viennent pas souvent de l’intérieur – contrairement à l’innovation dite « continue » – mais sont généralement imposées de l’extérieur, sous la pression de l’ennemi par exemple. On y voit également les viscosités et les biais cognitifs à l’œuvre, que ce soit l’effet générationnel des décideurs, la propension des armées à reproduire des modèles connus, la rivalité entre les services d’une même armée ou encore l’illusion de pouvoir piloter de manière centralisée le cycle du changement. Le rôle du politique pour faire passer les évolutions de rupture est également mis en avant, tout comme l’importance de créer les conditions de l’émergence d’un courant de pensée libre de réflexion non institutionnelle – que l’auteur considère d’ailleurs comme une forme indispensable de « réserve » opérationnelle pour les temps mauvais. On retiendra enfin l’importance pour une organisation militaire de pouvoir expérimenter, grâce à un surplus de ressources matérielles et de temps libre, comme ce fut le cas notamment dans les décennies qui précédèrent la Première Guerre mondiale : « Plus les unités disposent de temps libre et de moyens autonomes, et plus ce capital d’adaptation rapide est important. Inversement, plus les moyens sont comptés, surveillés et centralisés, et plus l’armée devient rigide. »
Au-delà de la rétrospective historique, le principal intérêt de l’ouvrage est ainsi l’analyse percutante que livre Michel Goya sur les conditions d’apparition de cette innovation au sein d’une structure militaire. S’adapter pour vaincre montre comment les innovations de rupture ne viennent pas souvent de l’intérieur – contrairement à l’innovation dite « continue » – mais sont généralement imposées de l’extérieur, sous la pression de l’ennemi par exemple. On y voit également les viscosités et les biais cognitifs à l’œuvre, que ce soit l’effet générationnel des décideurs, la propension des armées à reproduire des modèles connus, la rivalité entre les services d’une même armée ou encore l’illusion de pouvoir piloter de manière centralisée le cycle du changement. Le rôle du politique pour faire passer les évolutions de rupture est également mis en avant, tout comme l’importance de créer les conditions de l’émergence d’un courant de pensée libre de réflexion non institutionnelle – que l’auteur considère d’ailleurs comme une forme indispensable de « réserve » opérationnelle pour les temps mauvais. On retiendra enfin l’importance pour une organisation militaire de pouvoir expérimenter, grâce à un surplus de ressources matérielles et de temps libre, comme ce fut le cas notamment dans les décennies qui précédèrent la Première Guerre mondiale : « Plus les unités disposent de temps libre et de moyens autonomes, et plus ce capital d’adaptation rapide est important. Inversement, plus les moyens sont comptés, surveillés et centralisés, et plus l’armée devient rigide. »












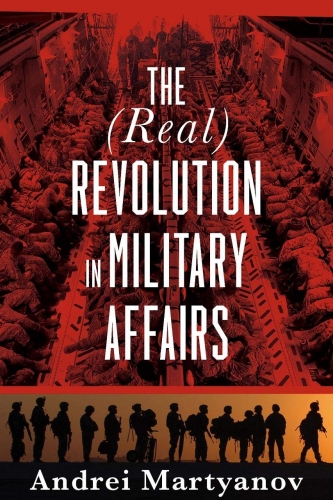
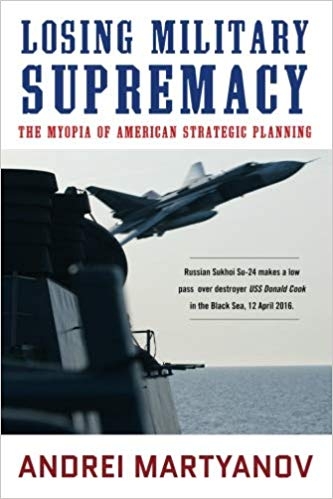







 Question :
Question : 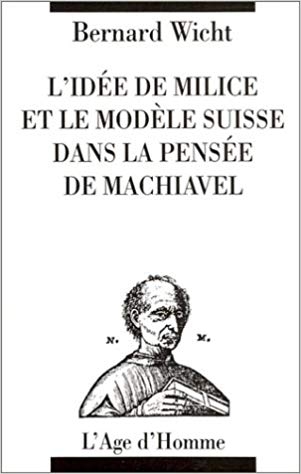 poque moderne. C’est pourquoi il est possible de parler de rupture civilisationnelle. En outre, ces nouvelles machines de guerre ne représentent pas qu’une adaptation réussie de l’outil militaire aux conditions de la mondialisation. Elles s’inscrivent dans une dialectique empire/barbares traduisant la résistance à l’ordre global.
poque moderne. C’est pourquoi il est possible de parler de rupture civilisationnelle. En outre, ces nouvelles machines de guerre ne représentent pas qu’une adaptation réussie de l’outil militaire aux conditions de la mondialisation. Elles s’inscrivent dans une dialectique empire/barbares traduisant la résistance à l’ordre global.







 Au total, 691 soldats ont été tués par la PIRA (dont 197 UDR) et 6 par les loyalistes protestants. De leurs côté, les militaires ont abattus 121 PIRA, 10 loyalistes et 170 civils. La PIRA a tué 1457 civils dont, par règlements de compte, 162 autres « républicains » (c’est-à-dire plus que l’armée), et 28 loyalistes. Ces derniers ont tués 1071 civils.
Au total, 691 soldats ont été tués par la PIRA (dont 197 UDR) et 6 par les loyalistes protestants. De leurs côté, les militaires ont abattus 121 PIRA, 10 loyalistes et 170 civils. La PIRA a tué 1457 civils dont, par règlements de compte, 162 autres « républicains » (c’est-à-dire plus que l’armée), et 28 loyalistes. Ces derniers ont tués 1071 civils. 


Als rechts Verortete nehmen wir teil an vielfältigen Einbrüchen in die Theoriefelder der Linken. Die Theorieschwäche dieses Gegners äußert sich vornehmlich in abgestandener Phraseologie, die losgelöst von jedem „Sitz im Leben“ gedroschen wird. Reicht auch das nicht aus, den intellektuellen Bankrott zu kaschieren, geht man schnell zu einem Wild-um-sich-schlagen über, das als Ersatz für eine tragfähige Selbstvergewisserung herhalten muss.
Zu den Gebieten, auf denen die Linke sich noch im Hausrecht wähnt, da sie es vor allem in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts annektiert hatte, gehört der Guerillakrieg. Seit Mao und Che zu den Hausgöttern der radikalen Linken erhoben wurden, wird übersehen, dass es auch auf der rechten Seite Strategen des „kleinen Krieges“, mithin des Volkskrieges, gegeben hat. Diese weniger bekannten Figuren waren ebenso Volksbefreier, wie Ho, Mao oder Che zu sein vorgaben, nur ohne revolutionäres Schleppnetz und soziale Experimentierlust.
Zu nennen wären für die Nachkriegszeit Georgios Grivas und seine griechisch-zypriotische EOKA oder der rechte Zionist Menachem Begin und sein IRGUN ZWAI LEUMI. Dessen Erinnerungen unter dem Titel The Revolt gehörten lange zur klammheimlichen Pflichtlektüre angehender Untergrundkämpfer an den westlichen „Metropolenfronten“.
In dieser Reihe hätte auch ein bretonischer Haudegen seinen Platz, der die leidvolle Erfahrung seiner Generation wie seines Landes mit der gewaltsamen Dekolonisierung in einer Strategie der Gegenrevolution fruchtbar machen wollte. Oberst Pierre Chateau-Jobert (1912-2005) hatte aufgrund seiner militärischen Erfahrungen im Maquis (Selbstbezeichnung französischer, aber auch spanischer Partisanen) des Zweiten Weltkriegs sowie im terroristischen Abenteuer der OAS klare Vorstellungen davon, wie Guerilla von rechts auszusehen hätte und wie nicht. Er war kein bedingungsloser Parteigänger der Gewaltlosigkeit, aber ein strenger Lehrer präzise dosierter Gewaltanwendung als ultima ratio.
Er hatte sowohl von der Unbarmherzigkeit des Feindes gelernt als auch von der Stümperhaftigkeit der Kampfgefährten in der OAS. Beides verbannte er aus seiner Lehre vom modernen konterrevolutionären Volkskrieg. Das macht ihn für deutsche Leser zu einer originellen Mischung aus Carl von Clausewitz und Karl-Heinz Hoffmann. Es ist gewiss nicht ungefährlich, seine Gedanken heute wiederzugeben, gefährlicher jedoch wäre auf lange Sicht ihr vollständiges Ignorieren. Die Zeiten werden nicht friedlicher. Wer wird uns beistehen?
Der Augenzeuge
In einem Interview aus dem Jahr 1976 sagte Pierre Chateau-Jobert, dass er in der Realität des Krieges erfahren hatte, was die revolutionäre Maxime, dass der Zweck die Mittel heilige, konkret bedeute. Diese traumatische Erfahrung leitete ihn auf den Stationen seiner militärischen Laufbahn ebenso wie auf den verschlungenen Wegen des rechten Untergrundes im Frankreich der V. Republik. Es sind die Augen eines Berufsmilitärs, die ohne Scheuklappen die Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen bewaffneter Aktionen gegen die seinerzeit allgegenwärtig geglaubte kommunistische Gefahr betrachten. Leichtfertigkeit wie Defätismus sind ihm gleichermaßen zuwider.
Geboren wird Pierre Alexandre Joseph Chateau-Jobert 1912 in Morlaix, einer Kleinstadt in der Bretagne in eine konservativ-katholische Familie. Der Vater war im Ersten Weltkrieg gefallen. Die Mutter versucht, die Familie mit einem kleinen Buchladen über Wasser zu halten. Der Traum des Jungen ist es, der Marine beizutreten, doch gesundheitliche Probleme kommen dazwischen, so dass dieser Traum zerplatzt. 1934 tritt er stattdessen in das französische Heer ein. Er besucht die Artillerieschule und wird als sous-lieutenant(eine Art Fähnrich) 1940 bei einem deutschen Luftangriff schwer verwundet. Als er aus dem Koma erwacht, hat Frankreich kapituliert.
Pierre Chateau-Jobert will weiterkämpfen und gelangt zu de Gaulle nach London. Unter dem Decknamen „Conan“ kommt er nach diversen Einsätzen in Afrika (bei der Fremdenlegion) schließlich zu den Fallschirmjägern, genauer zur französischen Sektion des gerade im Aufbau befindlichen britischen SAS. Hier erlernt er erstmals die Grundlagen des verdeckten Kampfes. Er ist mittlerweile Hauptmann, als er im August 1944 über Frankreich mit dem Auftrag abspringt, zusammen mit dem örtlichen Maquis hinter den deutschen Linien für Verwirrung zu sorgen.
Am Ende des Zweiten Weltkrieges ist er bereits Bataillonskommandeur und Dozent an der Schule für Fallschirmjäger, als der Krieg ihn wieder ruft. Freiwillig geht Chateau-Jobert nach Indochina und hat hier, wie viele seiner Offizierskameraden, ein Erweckungserlebnis, was das verstörend Neuartige des revolutionären Krieges betrifft. Frankreich zieht Lehren aus dem Debakel von Dien Bien Phu und gehört militärisch zu den Vorreitern der später sogenannten counterinsurgency, einer breit gefächerten Strategie der Aufstandsbekämpfung, welche die in Asien nachfolgenden US-GIs damals noch mit Geringschätzung zur Kenntnis nehmen.
Chateau-Jobert kehrt auf den Katheder zurück und kommt 1955 zum Generalstab nach Algerien. Noch als Mittvierziger springt er in der Suezkrise mit dem 2. Régiment de Parachutistes Coloniaux, zu dem auch ein junger Leutnant namens Jean de Brem gehört, welcher später das berühmte „Testament eines Europäers“ verfassen wird, über Port Said ab. Im Algerienkrieg kommt es für ihn wie für viele Offiziere, die auf der Grundlage ihres Eides und ihres (blinden) Vertrauens in den neuen Präsidenten Charles de Gaulle für ein französisches Algerien kämpfen zum Schwur.
Als er es wagt, während des Putsches 1961 seinen unmittelbaren militärischen Vorgesetzten für die Sache der putschenden Generäle von Algier zu gewinnen, wird er verhaftet. Oberst Pierre Chateau-Joberts Karriere in der französischen Armee ist damit beendet. Nach seiner Haftentlassung wartet er vergeblich auf eine Wiederverwendung. Die kommt von einer ganz anderen Seite, nämlich von der rechtsgerichteten Untergrundarmee OAS (Organisation de l’armée secrète), die mit Terror für die Belange der Algerienfranzosen streitet. Die Erfahrung mit dem Terrorismus und dem Agieren im Untergrund bildet die zweite wichtige Prägung im Leben des Soldaten Chateau-Jobert.
Von den Querelen innerhalb der OAS-Führung angewidert, von ihrer kriminellen Entartung abgestoßen (hier vergleichbar mit Dominique Venner), nutzt er die Zeit im Untergrund, um sich philosophisch, theologisch und politisch weiterzubilden. Er gerät dabei unter den Einfluss nationalkatholischer Kreise um den Publizisten Jean Ousset, einstiger Sekretär von Charles Maurras und Bekannter von Erzbischof Marcel Lefebvre. Frucht dieser Zusammenflüsse von Praxis und Theorie, gleichsam von Schwert und Buch, ist u.a. sein Kompendium La Confrontation Révolution/Contrerévolution, aus dem die folgenden Überlegungen stammen.
Der Exorzist
Jeder Widerstand beginnt mit einer gesunden Doktrin. Sie liefert die unerlässliche Kampfmoral. Dies zu wiederholen, wird Chateau-Jobert nicht müde. Sie bildet gleichsam die Grundierung für alles, was folgt und ist gleichzeitig der Maßstab, an dem sich alle Aktionen zu messen haben. Widerstand ohne Doktrin entartet oder verliert nach den zu erwartenden Rückschlägen seinen Antrieb. Zu dieser Doktrin, die für den passionierten Antikommunisten Chateau-Jobert nur die christlich-abendländische sein kann, gehört die klare Identifizierung des Feindes.
Der Feind ist die Revolution und dies meint für den Autor nicht eine historisch bestimmte in einer geschichtlichen Abfolge von Revolutionen, sondern die Revolution als quasi metaphysische Größe. Die REVOLUTION, so der Oberst, sei die permanente Auflehnung gegen die gottgewollte Schöpfungsordnung. Sie allein gelte es in all ihren Verkleidungen und zeitgebundenen Erscheinungsformen aufzuspüren und zu bekämpfen. Sie ist das Prinzip des Bösen schlechthin, „une force du mal“.
Die philosophisch-theologischen Ausführungen des Autodidakten geraten im weiteren Verlauf dieses Kapitels unweigerlich in die Nähe der Mythomanie. Sein verbissener Kampf gegen diesen mehr imaginierten Feind ist von einer stark reaktionären Note durchtränkt. Die Revolution ist hier keine einzelne Doktrin, sondern die von Anbeginn der Welt subversiv wirkende Kraft des Widersachers. Chateau-Jobert verfolgt sie wie einen Top-Terroristen, analysiert sie und warnt vor ihren Schlichen. Revolution will nur ihre eigene Dauer und dazu ist ihr jedes Mittel recht. Alle Milieus stehen in der Gefahr kontaminiert zu werden, selbst die Kirche.
Die Passivität der Arglosen ist ihr ebenso Katalysator wie der hehre Idealismus der allzu Wohlgesinnten oder der Fanatismus der Überzeugungstäter. Chaos ist ihr Komposthaufen, auf dem sie gedeihen kann. Aber auch vermeintlich vernünftige Sachlichkeit kann sie voranbringen. Und so nimmt es nicht Wunder, dass Chateau-Jobert neben Marx und Mao auch de Gaulle und Roosevelt zu den „Revolutionären“ zählt.
Aus dem Gesagten ergibt sich für Chateau-Jobert die Notwendigkeit, den konterrevolutionären Widerstand metaphysisch zu verankern. Die christliche Lehre, ihre Zivilisationsform und nicht zuletzt die gottgewollte Schöpfungsordnung bilden nicht nur die Moral in diesem Kampf, sondern bestimmen auch die Mittel der Wahl. Sollte die Wahl auf die Gewalt fallen müssen, so wird sie nicht einfach von der Kette gelassen, sondern domestiziert angewandt. Nicht nur der Glaube verbietet das Gegenteil, sondern auch nüchterne strategische Überlegungen, wie noch zu zeigen sein wird.
In der bedingungslosen Friedenssehnsucht willensschwacher Menschen kann der Soldat Chateau-Jobert nur den baldigen Sieg der Revolution ausmachen. Es geht weder ums „Gesundbeten“ noch um die Flucht in eine spirituelle Arche Noah, sobald sich der Kampf aufdrängt. Der Prediger Chateau-Jobert bleibt immer und zuvorderst Militär.
Der Kämpfer
Es muss sehr viel passieren, damit der Kampf eine bewaffnete Komponente erhält, auch dies wird vom Autor regelmäßig wiederholt. Denn eines will Chateau-Jobert um jeden Preis verhindern: Terrorismus. Niemandem, der sich dem konterrevolutionären Kampf anschließt, gesteht er das Recht zu, individuell und auf eigene Faust gewaltsam loszuschlagen. Ein solches Vorgehen zerstört mehr, als es einbringen würde und das innerhalb kürzester Zeit. Ein Neubeginn nach einer Gewaltorgie müsste buchstäblich bei null beginnen. Ebenso erteilt er Putschgelüsten eine Absage, da es hierfür besondere Bedingungen braucht, die sich nur äußerst selten einstellen. Ein Putsch ohne einen bereits verwurzelten gesellschaftlichen Rückhalt bleibt ein isoliertes Hasardeurstück.
Was Chateau-Jobert aus eigener Erfahrung vorschwebt, ist ein geschmeidiger Untergrund, der nichts mit dem klassischen Untergrund zu tun hat, der mit Decknamen und martialisch klingenden Geheimarmeen operiert. Aus seiner Aversion gegen gesonderte Namensgebungen bzw. „Taufen“ von Bewegungen wie Mitgliedern macht er keinen Hehl. Was keinen Namen hat, existiert offiziell nicht. Untergrund im Sinne Chateau-Joberts heißt nicht, dass Aktivisten von der Bildfläche verschwinden müssen, um fortan Unmengen an Energie für die Deckung von Operationen wie für die Eigensicherung aufzuwenden. Untergrund, wie er ihn versteht, ist viel eher das geschickte Einbetten von Aktivitäten in das natürliche Umfeld der Handelnden. Alles muss sich an diesem natürlichen Umfeld ausrichten, so dass Verdacht gar nicht erst aufkommt. „L’action est à mener par chacun dans son propre milieu“ („Jeder muss innerhalb seines Milieus die Aktion durchführen“).
Selbst wenn die Möglichkeit von Gewalt durchgespielt wird, dürfe dies nicht so aussehen, als beginne man mit den Vorbereitungen für einen Aufstand. Vor allem die Bewegungsfreiheit, einer der wichtigsten Freiheiten im verdeckten Kampf, darf nicht leichtfertig geopfert werden. Kontakte ergeben sich aus diesem normalen Umfeld quasi von allein und erregen keine erhöhte Aufmerksamkeit. Gleichwohl sind in der vormilitärischen Phase die Tugend größtmöglicher Verschwiegenheit und das Einüben von Disziplin ein Muss. Da Ermittler stets nach dem berühmten roten Faden suchen, der sie vom Rand in den Kern einer Gruppe führt, muss jedes Mitglied sich bewusst sein, selber solch ein roter Faden zu sein. Daher gilt: Fremde und Neugierige von außerhalb des natürlichen Beziehungsgeflechts sind auf Abstand zu halten, ohne dass gleich Geheimniskrämerei in der Luft liegt. Jeder und jede aus diesem natürlichen Netz ist aufgefordert, sich einzubringen und mit den möglichen Eskalationsstufen des Kampfes vertraut zu machen bzw. zu „akklimatisieren“.
Aktive Geduld
Diese Phase erhält von Chateu-Jobert die treffende Bezeichnung „patience active“, die Phase der „aktiven Geduld“. Sie kann unter Umständen sehr lange dauern und ist als Grundierungsphase unverzichtbar. Die mühevolle „Kärrnerarbeit“ im natürlichen Hintergrund eines jeden ist die eigentlich wichtige Arbeit, sie darf nie unterschätzt werden.
Die heiße Phase der bewaffneten Eskalation wird niemals von den Konterrevolutionären selber ausgehen. Im Gegenteil: Sie drängt sich auf, vor allem dann, wenn letzte Hüllen fallen, wenn die Gewalt großflächig zur Herrschaft gelangt ist, immer mehr Opfer fordert, die bisherige Ordnung zum Einsturz gebracht hat und von einer revolutionär gesinnten Regierung gar selber angewandt wird. Der Konterrevolutionär nach dem Geschmack Chateau-Joberts wird diesem Kampf nicht ausweichen, wird ihn aber überlegt und weitsichtig führen. Ein Kämpfer in diesem Sinne muss immer auch zivile Kompetenzen haben (viele „Volksbefreier“ hatten sie nicht). Er muss bestrebt sein, die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen und dauerhaft zu erhalten, was eine unabdingbare Voraussetzung für jeden Maquis darstellt.
Diese Unterstützung hat er in der „Phase der aktiven Geduld“ gründlich vorbereitet und kann sich im Ernstfall auf sein lokales Umfeld verlassen. Eine Waffe werden auch dann nur wenige tragen bzw. einsetzen. Das Netz der résistants, d h. der zivilen Unterstützer, wird immer größer sein, als die Gruppe der eigentlichen combattants. Letztere tragen besondere Verantwortung als militärische Kombattanten. Ihre Auswahl unterliegt strengen Regeln, ihre Anzahl variiert von Region zu Region (im Mittel 30 auf 100 Quadratkilometer, verteilt in Gruppen von 3-6 Mann). Ihre taktische Ausrichtung ist klar offensiv, da ein Maquis nur dann angreift, wenn er auch siegen kann.
Er schlägt hart zu, zieht sich zurück und unterlässt dabei jede Art von Repressalien. In solcherart Krieg wird nicht überall gekämpft werden müssen und nicht überall mit gleicher Intensität. Idealerweise bringen die Mitglieder solcher Einheiten militärische Erfahrung mit und sind bereit, die Kampfhandlungen einzustellen und die Gruppe aufzulösen, wenn es gefordert wird. Gestaltet sich der Kampf als konventioneller Krieg, werden die Partisanen in reguläre Armeeeinheiten der konterrevolutionären Partei überführt. (Ähnlich de Gaulle, der bei der Libération keine Irregulären an seiner Seite duldete).
Die Frage nach einem zentralen Kommando bleibt jedoch offen. Chateau-Jobert widerstrebt es, seiner Losung getreu, Systematisierungen oder Organigramme aufzustellen und jedes Detail akribisch zu beleuchten. Vieles verbleibt in der Entscheidung vor Ort. Der Partisan ist eine lokale Erscheinung und findet seine Unterstellungen wie seine Handlungsmöglichkeiten innerhalb des zuvor beschriebenen natürlichen Umfelds, aus dem er hervorgeht. Bindende Richtschnur bleibt in jedem Fall die Doktrin, der jeder wahre Konterrevolutionär wie einem Oberbefehlshaber zu folgen hat.
Ausblick: der erste Schuss
Am sogenannten Fulda Gap, der geografischen Pfeilspitze des Warschauer Paktes in Osthessen, wartete man auf ihn während des gesamten Kalten Krieges vergebens, glücklicherweise. Der erste Schuss des Dritten Weltkrieges wäre dort gefallen, so waren sich US-Analysten sicher. Dementsprechend fielen die Vorbereitungen an diesem Sektor aus.
Zweimal krachten „erste Schüsse“ in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo, einmal 1914 und ein weiteres Mal 1992, als ein bosnischer Gangster in eine serbische Hochzeitsgesellschaft feuerte. Konflikte von weitreichender Bedeutung folgten – in beiden Fällen. Der Erste Weltkrieg verheerte die überkommene europäische Staatenordnung. Der bosnische Bürgerkrieg trieb als Teil der jugoslawischen Erbfolgekriege Religionen, Volksgruppen und bis dato friedliche Nachbarn gegeneinander, ein Menetekel.
Den erste Schuss in einem heute nur hinter vorgehaltener Hand gewisperten ethnischen Krieg in Europas Mitte kann man mit Bangen erwarten oder frohgemut verdrängen. Man mag dazu die Ausführungen eines Militärs wie Chateau-Jobert als verwegen belächeln, als nicht praktikabel abtun oder auch als Alarmismus und Kriegstreiberei resolut zurückweisen. Sicher sind sie verfrüht und an heutige Gegebenheiten anzupassen, insbesondere, was die technischen Möglichkeiten (Cyberwar, Drohnen etc.) angeht. Zudem würde sich die Frage aufdrängen, wo in Deutschland solche Szenarien überhaupt denkbar wären.
Gleichwohl täusche man sich nicht. Es reicht, sich auf der Grundlage beinahe alltäglicher Erfahrungswerte die aufkommenden Fragen überspitzter vorzulegen. Etwa so: Wann werden die neueingewanderten maghrebinischen Barbaresken des 21. Jahrhunderts mit groß angelegten Beutezügen durch unsere Ortschaften beginnen? Wann werden die nahöstlichen Clans in unseren Städten ihre Mitglieder zu kampfeslustigen Armeen mit politischer Zielsetzung organisieren? Wie verhalten sich dazu die Erdogan-Türken und ihr Kalif am Bosporus? Wie wird die unvermeidliche Antifa den sich zur Wehr Setzenden in den Rücken fallen? Und schließlich: Wer oder was wird von staatlicher Seite all dem entgegentreten?
Si vis pacem para bellum, lautet ein vielzitierter Grundsatz aus dem antiken Rom. Die duritia der alten Römer vertrug sich nicht mit Wehrlosigkeit, von der man zu Recht ahnte, dass sie nicht friedensfördernd war, wie manche Zeitgenossen heute allen Ernstes glauben machen wollen. Man lasse sich nicht täuschen und behalte eine Tagebucheintragung von Pierre Drieu la Rochelle unter dem 23. November 1939 im Hinterkopf: „personne ne semble sentir que plus les événements tardent, plus ils seront terribles“ („Niemand scheint zu ahnen, dass die Dinge umso schrecklicher werden, je länger sie auf sich warten lassen“). Wer als Staatsbürger übrigbleibt, wenn die Institutionen, die ihm bislang alles abnahmen, zusammengebrochen sind, der ist aufgefordert, auch den Konfliktfall nicht mehr zu delegieren.
Literatur:
Bardèche, Maurice: Der Weg nach vorn, Göttingen, 1951.
Begin, Menachem: The Revolt, New York, 1977.
Chateau-Jobert, Pierre: La Confrontation Révolution-Contrerévolution, Chiré-en-Montreuil, 2015.
Chateau-Jobert, Pierre: Doctrine d’action Contrerévolutionnaire , Chire-en-Montreuil, 1986.
Chateau-Jobert, Pierre: Manifeste politique et social, Chire-en-Montreuil, 1973.
Chateau-Jobert, Pierre: Feux et Lumière sur ma trace. Faits de guerre et de paix, Paris 1978.
Grivas-Dighenis, Giorgios: Partisanenkrieg heute. Lehren aus dem Freiheitskampf Zyperns, 1964.
Passend dazu auch: Der vertagte Bürgerkrieg (BN-Anstoß IX).