Der Konflikt mit Weltkriegspotential um die iranischen Versuche, Atomkraft zu nutzen, besteht schon seit 2002, als bekannt wurde, dass das Land einige geheime Atomanlagen unterhielt. Ab 2005 begann der Konflikt dann zu eskalieren, als mit Mahmud Ahmadinedschad ein Islamist zum Präsident des Irans gewählt wurde. Er ersetzte den gemäßigten iranischen Unterhändler Hassan Rohani durch Ali Laridschani, der seinen kompromisslosen Standpunkt teilte.
Ahmadinedschads Rückzug ermöglichte eine friedliche Lösung
Von 2006 an wurden durch UN-Resolutionen und Maßnahmen der USA sowie der EU Embargos und Sanktionen zunächst für militärische und später auch für zivile Güter verhängt, die die wirtschaftliche Entwicklung des Landes seitdem massiv negativ beeinflusst haben. Die Aufhebung der Sanktionen war daher für das Land von unvorstellbarer wirtschaftlicher Bedeutung und eröffnet ein enormes Wachstumspotential in den nächsten Jahren.
Als 2012 Ahmadinedschad seinen Rückzug aus der Politik mit dem Ende seiner Amtszeit im August 2013 bekannt gab, entspannte sich die Lage erstmals und es konnte immerhin ein Übergangsabkommen abgeschlossen werden, was den IAEA-Kontrolleuren Zugang ermöglichte, den Iran zu einer Verlangsamung der Anreicherung verpflichtete und allgemein den Konflikt entschärfte, der insbesondere zwischen 2008 und 2011 beinahe zu einem militärischen geworden wäre. Seit dem 14. Juni 2013 ist nun der ehemals von Ahmadinedschad geschasste Unterhändler Hassan Rohani Präsident des Landes und betreibt eine Politik der Entspannung, was sich schon bald sehr positiv auf die Verhandlungslage auswirken sollte.
Durchbruch im April 2015
Anfang April des letzten Jahres gelang nun ein weiterer Durchbruch: Der Iran sicherte in Lausanne zu, sein Atomprogramm für zehn Jahre unter Aufsicht zu stellen, die Zentrifugen auf ein Drittel zu reduzieren, Uran nicht über 3,67 Prozent anzureichern und den Uranbestand von 10 Tonnen auf nur noch 300 Kilogramm zu verringern. Die „Breakout-Time“ für die Herstellung von genügend spaltbarem Material zum Bau einer Atombombe soll von nur noch drei Monaten auf immerhin ein Jahr erhöht werden. Des Weiteren wurde die Umgestaltung von zwei besonders problematischen iranischen Atomanlagen vereinbart. Am 16. Januar 2016 wurden auf Grund der bis dahin gegebenen Vertragstreue des Irans die Sanktionen schließlich aufgehoben.
Für Israel war das Abkommen ein Schlag ins Gesicht und ein Beleg für den immer weiter sinkenden Einfluss des Judenstaates, der nun nicht einmal mehr den traditionellen Partner USA von diesem Abkommen abhalten konnte. Die Mainstream-Republikaner aus dem Partei-Establishment in den Vereinigten Staaten waren ähnlich unzufrieden mit Obamas Kompromissvorschlag. Hauptkritikpunkt war der Umstand, dass das illegale Programm des Irans nun letztlich doch legitimiert worden sei und das Land, selbst wenn es sich an das Abkommen halten sollte, immer noch in nur einem Jahr zur Atombombe kommen könnte.
In Wahrheit war der Abschluss des Abkommens, an dem auch Deutschland einen enormen Anteil hatte, wohl alternativlos in diesem festgefahrenen und brandgefährlichen Konflikt. Sollte die Einhaltung der Vereinbarungen nun auch entsprechend sichergestellt und kontrolliert werden, könnte das Abkommen als einer der wenigen Erfolge Obamas in die Geschichte eingehen. Wäre 2008 hingegen McCain Präsident geworden, hätte es wohl stattdessen einen militärischen Konflikt von unabschätzbarem Ausmaß gegeben.
Rohani greift nun den Dollar an
Auch für die deutsche Wirtschaft hat sich die Aufhebung der Sanktionen als absolut positiv herausgestellt. Noch im Januar reiste Sigmar Gabriel nach Teheran und auch Rohani reiste durch Europa, um die sich bereits abzeichnenden Kooperationen mit der Automobilindustrie, der Pharmaindustrie, der Kommunikationsbranche und natürlich dem Energiesektor zu besprechen. Allein Siemens hofft auf den Auftrag, eine rund 1000 Kilometer lange Hochgeschwindigkeitstrasse bauen und 500 Züge liefern zu dürfen.
Doch ist Rohani womöglich nur geschickter als Ahmadinedschad? Vielleicht hat er den Atomstreit, der das Land seit mehr als zehn Jahren lähmt, als Sackgasse begriffen und will nun den Iran über die wirtschaftliche Schiene zur Großmacht und zum Einflussfaktor weit über die Region hinaus machen. Dafür sprechen sein rigoroses Vorgehen gegen Blogger und Internetaktivisten und der massive Anstieg der Todesstrafen nach seinem Wahlsieg. Nach dem Knüpfen wirtschaftlicher Beziehungen folgte nun schließlich der nächste Paukenschlag: Ölgeschäfte wird der Iran künftig in Euro abwickeln – und nicht mehr mit der bisherigen De-Facto-Weltwährung US-Dollar. Auch China bezahlt bereits russisches Öl in seiner Landeswährung Yuan.
Wird der Euro doch noch gerettet?
Eventuell ist also in den nächsten Jahren damit zu rechnen, dass Russland, China und der Iran ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen und der US-Dollar international an Bedeutung verliert. Dies wäre wohl auch der einzige Weg für die autoritäreren Schwellenländer die USA zu schlagen: Was militärisch kaum möglich ist, kann über eine Entwertung des Dollars recht leicht erreicht werden. Einziger Wehrmutstropfen: Auch die Chinesen haben gigantische Dollar-Reserven, die in diesem Fall entwertet würden. Deshalb will das Großreich künftig stärker diversifizieren: Gerade der Euro soll im Blick sein. Retten also am Ende geostrategische Überlegungen östlicher Großmächte die angeschlagene Gemeinschaftswährung? Der jüngste Schritt des Irans dürfte jedoch nicht nur eine Schwächung der USA, sondern auch eine engere Bindung Europas an sich zum Ziel gehabt haben, um künftige Sanktionen unwahrscheinlicher zu machen.



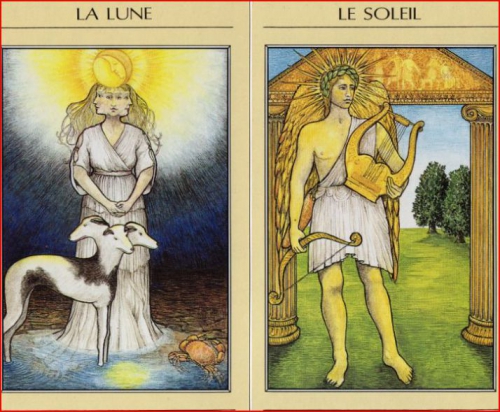

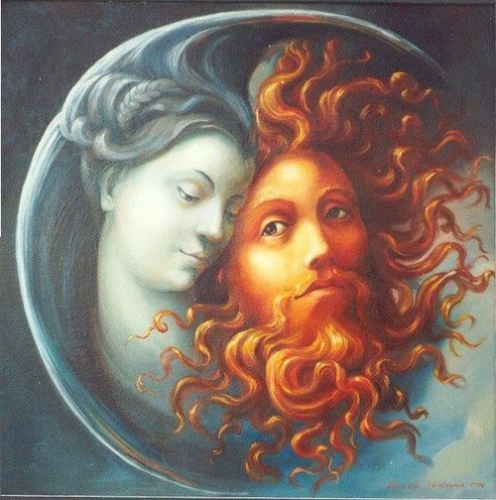 Lorsque les peuples sémitiques quittèrent leur foyer d’Afrique de l’Est ou de la pointe sud-ouest de l’Arabie, leur mythologie rencontra celle des Mésopotamiens. A l’origine, le Soleil chez les Sémites est une déesse du nom de *Śamšu alors que la Lune est masculine, *Warihu. Chez un peuple qu’on associe à un environnement semi-désertique, c’est assez surprenant. Lorsque les Sémites envahirent Sumer, ils adaptèrent leur panthéon à celui des indigènes. Si la lune resta masculine sous la forme du dieu Sîn, dont l’actuel Sinaï porte le nom, le soleil devint également masculin. A l’Utu sumérien succéda le Shamash babylonien, dans son rôle identique de dieu qui voit tout et juge les hommes. Mais en Canaan et chez les Arabes, « la » Soleil survécut. Shapash était la déesse ouest-sémitique du soleil, présente aussi bien chez les anciens Judéens que dans le reste de Canaan et jusqu’à Ugarit, et Shams la déesse sud-sémitique, présente encore à l’époque de Muhammad dans tout le Yémen.
Lorsque les peuples sémitiques quittèrent leur foyer d’Afrique de l’Est ou de la pointe sud-ouest de l’Arabie, leur mythologie rencontra celle des Mésopotamiens. A l’origine, le Soleil chez les Sémites est une déesse du nom de *Śamšu alors que la Lune est masculine, *Warihu. Chez un peuple qu’on associe à un environnement semi-désertique, c’est assez surprenant. Lorsque les Sémites envahirent Sumer, ils adaptèrent leur panthéon à celui des indigènes. Si la lune resta masculine sous la forme du dieu Sîn, dont l’actuel Sinaï porte le nom, le soleil devint également masculin. A l’Utu sumérien succéda le Shamash babylonien, dans son rôle identique de dieu qui voit tout et juge les hommes. Mais en Canaan et chez les Arabes, « la » Soleil survécut. Shapash était la déesse ouest-sémitique du soleil, présente aussi bien chez les anciens Judéens que dans le reste de Canaan et jusqu’à Ugarit, et Shams la déesse sud-sémitique, présente encore à l’époque de Muhammad dans tout le Yémen.
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg A l’origine des Européens, il y avait un peuple préhistorique. Il n’a laissé aucune trace tangible, aucune écriture aisément reconnaissable, à part quelques symboles solaires abandonnés sur quelques pierres, depuis l’Irlande jusqu’à la Russie. Les linguistes du XIXème siècle, qui en ont découvert l’existence en comparant entre elles les langues de l’Europe moderne avec celles de plusieurs peuples d’Asie, ont appelé ce peuple les Indo-Européens car leurs héritiers ont peuplé un espace allant de l’Europe entière jusqu’à l’Iran et au nord de l’Inde.
A l’origine des Européens, il y avait un peuple préhistorique. Il n’a laissé aucune trace tangible, aucune écriture aisément reconnaissable, à part quelques symboles solaires abandonnés sur quelques pierres, depuis l’Irlande jusqu’à la Russie. Les linguistes du XIXème siècle, qui en ont découvert l’existence en comparant entre elles les langues de l’Europe moderne avec celles de plusieurs peuples d’Asie, ont appelé ce peuple les Indo-Européens car leurs héritiers ont peuplé un espace allant de l’Europe entière jusqu’à l’Iran et au nord de l’Inde. Leur religion était celle d’hommes libres. Les dieux étaient honorés autour de sanctuaires de bois, avec des « idoles » de bois pour les personnifier et servant d’objet intermédiaire pour les contacter. Tous savaient que les dieux vivaient au ciel (*akmon, un « ciel de pierre ») et pas dans des sculptures. Ils possédaient sans doute des temples de bois (*temenom) réservés aux prêtres. Les figures divines étaient aussi bien masculines que féminines, sans que les unes aient un ascendant sur les autres, à l’exception du ciel-père (*dyeus) et de la terre-mère (*dhghōm), son épouse. Le rapport entre l’homme et le dieu n’était pas celui entre un esclave et son maître, mais entre amis, même si l’un était mortel et l’autre immortel. Les dieux se mêlaient aux mortels et parfois s’unissaient à certains d’entre eux, faisant naître des héros et des protecteurs. Ils n’avaient pas besoin de créer un mot comme « laïcité » car ils l’étaient par nature.
Leur religion était celle d’hommes libres. Les dieux étaient honorés autour de sanctuaires de bois, avec des « idoles » de bois pour les personnifier et servant d’objet intermédiaire pour les contacter. Tous savaient que les dieux vivaient au ciel (*akmon, un « ciel de pierre ») et pas dans des sculptures. Ils possédaient sans doute des temples de bois (*temenom) réservés aux prêtres. Les figures divines étaient aussi bien masculines que féminines, sans que les unes aient un ascendant sur les autres, à l’exception du ciel-père (*dyeus) et de la terre-mère (*dhghōm), son épouse. Le rapport entre l’homme et le dieu n’était pas celui entre un esclave et son maître, mais entre amis, même si l’un était mortel et l’autre immortel. Les dieux se mêlaient aux mortels et parfois s’unissaient à certains d’entre eux, faisant naître des héros et des protecteurs. Ils n’avaient pas besoin de créer un mot comme « laïcité » car ils l’étaient par nature.