Le Pentagone a découvert un nouveau « Klondike » en Afghanistan. Près de 1 000 milliards de dollars seraient enfouis dans le sous-sol du pays, ce qui en ferait un géant minier d’une taille comparable à celle de l’Australie.

Minéraux en Afghanistan (cliquez sur la carte pour l'agrandir)
Depuis longtemps, les géologues russes et américains avaient identifié d’importantes richesses minières en Afghanistan. Dans ses rapports annuels sur les pays, l’US Geological Survey (USGS) avait listé les minerais présents en abondance dans ce pays : cuivre, or, minerai de fer, marbre, nickel, soufre, talc… Toutefois, Chin S. Kuo, le responsable de l’étude, notait que l’absence d’infrastructures, de main-d’œuvre qualifiée, sans oublier les problèmes non résolus de sécurité, interdisaient pour le moment l’exploitation de ces richesses.
Selon l’étude de l’USGS, les réserves cuprifères (prouvées et possible) du pays atteindraient 60 millions de tonnes (Mt). Une fraction des 3 milliards de tonnes possible, probable et vérifiée estimées par l’USGS, dans le monde. Celles, prouvées de minerai de fer s’établiraient à 2,2 milliards de tonnes. Une quantité respectable, mais limitée en comparaison des 160 milliards de tonnes estimées par l’organisme américain ou des 20 milliards de tonnes détenues par l’Australie. Les réserves du pays avaient également été examinées dans une enquête du Mining Journal publiée en 2006.
Activité « artisanale », le secteur primaire afghan ne produit annuellement pas plus de 150 000 tonnes de charbon, 50 000 tonnes de ciment, 7 000 tonnes de chromite, 20 000 barils de pétrole brut et 50 millions de mètres cubes de gaz naturel. Seul gisement de grande taille, la mine de cuivre d’Aynak dans la province de Logar a été attribuée en 2007 à l’entreprise chinoise China Metallurgical Group, pour une durée de 30 ans. Pour obtenir ce contrat, MGC a dû verser plus de 3 milliards de dollars, un milliard de plus que n’étaient prêts à verser les grands mineurs internationaux.
Outre les métaux ferreux et les métaux de base, l’Afghanistan dispose également d’importantes réserves de métaux mineurs dit stratégiques : tantale, niobium, béryllium, ainsi que de lithium sous plusieurs formes.
Malgré leur richesse, ces gisements n’étaient jusqu’à présent pas identifiés à hauteur de 908 milliards de dollars, comme le décrit un mémo du Pentagone cité par le New York Times. « Il y a là un extraordinaire » potentiel, a surenchéri le général David Petraeus, commandant en chef des troupes des Etats-Unis en Afghanistan. Affirmant avoir utilisé des documents datant de l’occupation soviétique, l’Etat-major n’hésite pas à reprendre les superlatifs, recyclant l’expression « Arabie Saoudite du lithium », pour en affubler l’Afghanistan.
Interrogée par le Washington Post, Stephanie Sanok, qui travaille sur ce type de question pour l’Ambassade des Etats-Unis en Irak, a rappelé que si « tout le monde est au courant », de la richesse minière du pays, « il n’y a aucun moyen de l’atteindre ». Pour Craig Sainsbury, un analyste de Citigroup qui a récemment effectué une évaluation des plus grandes mines du monde, l’estimation du Pentagone, qui mettrait l’Afghanistan au niveau de l’Australie, est bien trop élevée. De plus, évaluer la valeur d’un gisement sans poser la question des coûts de production n’a pas de sens. Particulièrement énergivore, l’extraction minière serait extrêmement difficile dans un pays dont la production d’électricité est au niveau des Iles Féroé.
La richesse minière potentielle de l’Afghanistan pourrait aussi bien l’aider à stabiliser son économie, qu’accentuer la guerre civile en cours. « Nous pouvons aussi bien devenir un nouveau Congo, qu’un Botswana ou un Chili », a commenté un ancien ministre des Finances afghan, Ashraf Ghani.
En janvier dernier, le Wall Street Journal expliquait que « le ministère des Mines est considéré comme l’un des départements les plus corrompus du gouvernement ». Les concessions sont attribuées en fonction des pots-de-vin et non des intérêts du pays, souligne le quotidien de Wall Street, mettant en cause l’attribution d’Aymak. Reconnaissant la difficulté à réunir les capitaux nécessaires à l’exploitation du cuivre ou du minerai de fer, l’USGS et le Département de la Défense tentent d’identifier les projets qui ne nécessitent pas autant de capitaux.
—————————–
D’autres articles sur le sujet :
L’Afghanistan disposerait de gigantesques réserves de minerais, dont du lithium
Des géologues américains ont découvert en Afghanistan de gigantesques réserves de minerais, dont du cuivre et du lithium, évaluées à plusieurs milliards de dollars, a rapporté lundi le New York Times.
Ces gisements, qui comprendraient également du fer, de l’or, du niobium et du cobalt, seraient suffisants pour faire de ce pays ravagé par la guerre un des premiers exportateurs mondiaux de minerais, ont estimé des responsables de l’administration américaine cités par le journal.
Les seules réserves de lithium de l’Afghanistan seraient ainsi comparables à celles de la Bolivie, détenteur des premières réserves mondiales, selon le New York Times.
Le lithium est un composant indispensable des batteries rechargeables, utilisé pour les téléphones et les ordinateurs portables ainsi que pour les automobiles électriques.
L’Afghanistan pourrait ainsi devenir « l’Arabie saoudite du lithium« , selon une note interne du Pentagone citée par le journal.
De même, les réserves de fer et de cuivre seraient susceptibles de faire de l’Afghanistan un des principaux producteurs mondiaux, selon les responsables cités par le journal
« Il y a là-bas un potentiel stupéfiant« , a déclaré au journal le général David Petraeus, chef d’Etat-major général, selon qui toutefois « il y a bien sûr beaucoup de ’si’ « . « Mais je pense que, potentiellement, c’est d’une immense portée« , a-t-il ajouté.
« Cela deviendra l’ossature de l’économie afghane« , a estimé pour sa part Jalil Jumriany, conseiller du ministère afghan des Mines, cité par le journal.
La découverte a été faite par une petite équipe de géologues et responsables du Pentagone, en s’appuyant sur les cartes et les données collectées par les experts miniers soviétiques durant l’occupation par l’URSS de ce pays durant les années 1980.
Les géologues afghans avaient caché chez eux pour les mettre à l’abri ces documents après le retrait de l’URSS, avant de les ressortir en 2001 après la chute des talibans.
« On avait les cartes, mais il n’y eu pas de suite, parce qu’on a eu 30 à 35 ans de guerre« , a déclaré Ahmad Hujabre, un ingénieur afghan qui travaillait au ministère des Mines dans les années 1970.
Selon le journal, le président Hamid Karzaï a été récemment informé de ces découvertes par un responsable américain.
—————————–
Du lithium pour les batteries en Afghanistan
Depuis 2001, les Américains cherchent désespérément Oussama Ben Laden dans les montagnes afghanes mais voilà que leurs efforts pourraient être récompensés. Si le riche Saoudien est toujours introuvable, en revanche, des géologues travaillant pour l’armée US viennent de découvrir que le sous-sol d’Afghanistan regorgeait de richesse en tous genres.
Outre le cuivre, le colbat, l’aluminium et l’or, ils auraient trouvé un important gisement de lithium, équivalent à celui de la Bolivie, actuellement premier fournisseur de ce métal.
Les esprits chagrins se demandent sans doute ce que viennent faire ces considérations minières au coeur d’un site consacré à l’actualité des télécoms. Les plus aguerris d’entre vous auront cependant fait le rapprochement : le lithium est un des principaux composants des batteries modernes, celles-là même qui alimentent les terminaux les plus performants du type iPhone.
On se souvient d’ailleurs qu’en 2008, d’inquiétants cas d’auto-combustion d’iPod nano s’étaient déclarés et qu’en août 2009 un iPod Touch avait explosé dans un jardin anglais. Dans chacun de ces cas, la batterie lithium-ion des appareils avait été incriminée. On imagine alors ce que les Talibans pourraient faire avec de telles quantités de lithium sous leurs pieds.
—————————–
Les réserves minières, une vaste opération de com’
Le 14 juin, The New York Times annonçait en une que les Etats-Unis avaient découvert de vastes gisements miniers en Afghanistan. En fait, cette information, connue depuis longtemps, apparaît pour l’armée américaine comme un moyen de justifier sa présence sur le terrain.
S’il n’était pas signé James Risen – ce grand reporter du New York Times est actuellement en conflit avec l’administration Obama, qui exige qu’il divulgue l’identité de ses sources -, l’article paru le lundi 14 juin à la une du quotidien : « U.S. Identifies Vast Riches of Minerals in Afghanistan » [Les Etats-Unis découvrent de vastes richesses minières en Afghanistan] aurait suscité une bonne dose de scepticisme. D’autant qu’une simple recherche sur Google fait apparaître un certain nombre d’articles plus anciens contenant des informations identiques.
L’administration Bush avait conclu en 2007 que l’Afghanistan était potentiellement assis sur de vastes réserves de minerais et que cet élément devait être pris en compte dans la politique américaine de soutien au gouvernement de Kaboul. Les Soviétiques étaient déjà au courant en 1985, comme le montre une histoire économique de la région depuis 2002 sur le site de l’Institut de technologie de l’Illinois : « L’Afghanistan possède des réserves d’une grande variété de minerais, notamment du fer, du chrome, du cuivre, de l’argent, de l’or, du talc, du magnésium, du mica, du marbre et du lapis-lazuli. Dès 1985, des études soviétiques signalaient également la présence de réserves potentiellement intéressantes d’amiante, de nickel, de mercure, de plomb, de zinc, de bauxite, de lithium et de rubis. Au milieu des années 1980, le gouvernement afghan s’apprêtait à exploiter à grande échelle certaines de ces ressources avec le soutien technique des Soviétiques. La priorité était donnée aux vastes réserves de fer et de cuivre du pays.«
Selon un ancien haut responsable du département d’Etat américain, des discussions sur la meilleure façon d’exploiter ces ressources à l’avenir étaient déjà en cours entre Washington et le gouvernement Karzaï dès 2006. Et, en 2009, le gouvernement afghan a commencé à lancer des appels d’offres pour divers projets d’exploitation minière.
La façon dont l’information a été présentée – avec des citations du général David Petraeus en personne, commandant des forces américaines en Afghanistan et en Irak, et de Paul Brinkley, promu pour l’occasion au poste de vice-ministre de la Défense – laisse penser à une vaste opération de communication visant à influencer l’opinion publique à propos de la guerre. En effet, comme le savent ceux qui ont lu les travaux du géographe américain Jared Diamond sur le déterminisme géographique, un pays possédant de vastes ressources en minerai tend vers la stabilité, pourvu qu’il soit doté d’un gouvernement central fort et stable.
Dans son article, Risen souligne que la découverte de ces réserves tombe à pic. Il parle notamment des réserves de lithium, un métal essentiel dans l’industrie électronique. Un haut fonctionnaire, lui, dit que l’Afghanistan pourrait devenir « l’Arabie Saoudite du lithium« , en référence à l’or noir qui a fait la richesse du royaume.
Le sentiment général qui prévaut aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde à propos de la guerre est que la stratégie américaine de contre-insurrection n’a pas réussi à asseoir le gouvernement Karzaï dans les régions hostiles. Et que cette stratégie est vouée à l’échec. Pour les théoriciens et les stratèges du Pentagone, ce n’est pas ainsi que les choses devaient tourner.
Quel meilleur moyen de rappeler aux gens – par « gens », je veux dire les Chinois, les Russes, les Pakistanais et les Américains – que le pays est promis à un avenir radieux que de diffuser ou rediffuser des informations valables mais déjà connues sur la richesse potentielle de la région ?
L’administration Obama et les militaires américains savent parfaitement qu’un article en une du New York Times attirera instantanément l’attention du monde. L’information est exacte, mais elle n’est pas si nouvelle que cela. Il faut s’interroger sur le contexte dans lequel intervient une telle révélation.
La « découverte » américaine fait sourire les Russes et saliver les Afghans
« Les cartes soviétiques ont aidé le Pentagone à trouver beaucoup de choses utiles en Afghanistan« , souligne le quotidien gouvernemental russe Rossiskaïa Gazeta à propos de la découverte de gisements miniers par des géologues américains dont fait état l’article du New York Times.
Il ne restait « plus qu’à se rendre sur place et à vérifier les données » collectées par les géologues soviétiques et archivées à la bibliothèque de Kaboul, écrit la presse russe. « Mille milliards de dollars en perspective« , titre le journal, en référence au montant auquel sont évaluées les réserves en minerai, notant que, comme en Irak avec le pétrole, c’est l’appât du gain qui motive les Américains en Afghanistan.
« Le mythe de l’Eldorado sert souvent à justifier l’expansion impériale. Les grandes puissances se persuadent souvent qu’il faut qu’elles contrôlent tel ou tel territoire éloigné parce qu’il est censé regorger d’or, de diamants, de pétrole, etc., et qu’un contrôle physique s’avère essentiel pour préserver l’accès à ces richesses« , rappelle le professeur de relations internationales Stephen Walt sur le site Internet du bimestriel américain Foreign Policy, qui a amplement commenté la « découverte » américaine.
En Afghanistan, le webzine Afghan Paper se réjouit de cette découverte, mais redoute un pillage des ressources, notamment en lithium, par les pays étrangers. « L’Etat afghan n’a pas les moyens financiers ni la stabilité politique nécessaires pour gérer au mieux l’exploitation d’un tel gisement. Il est possible que des pays tels que l’Inde, la Chine ou la Russie essaient de s’implanter davantage dans notre pays pour tirer profit de nos ressources en lithium. Quelles sont les chances que notre peuple profite un jour des retombées économiques de cette découverte ? Si les dirigeants de notre pays ne bradent pas entièrement le sol aux pays étrangers en ne pensant qu’à leur profit personnel, alors ce gisement sera notre chance pour ne plus dépendre des aides extérieures et affirmer une véritable indépendance.«
- Article original en anglais : The Atlantic
- Traduction française et encadré : Courrier International
—————————–
Afghanistan : le président Karzaï appelle le Japon à investir dans les minerais
Le président afghan Hamid Karzaï a appelé vendredi le Japon à investir dans les réserves colossales de minerais découvertes en Afghanistan, qui pourraient faire de ce pays ravagé par la guerre un des premiers exportateurs mondiaux.
Le gouvernement afghan a estimé jeudi à trois mille milliards de dollars la valeur de ces gisements, soit trois [fois] plus que les estimations des géologues américains révélées en début de semaine.
Selon un responsable du Pentagone, l’Afghanistan disposerait de réserves énormes de lithium, de fer, de cuivre, d’or, de niobium et de cobalt.
« Les perspectives de l’Afghanistan sont donc très bonnes« , a dit le président Karzaï. « L’Arabie saoudite est la capitale mondiale du pétrole et l’Afghanistan va devenir la capitale mondiale du lithium.«
Le lithium est un composant indispensable des batteries rechargeables, utilisé pour les téléphones et les ordinateurs portables ainsi que pour les automobiles électriques.
Les seules réserves de lithium de l’Afghanistan seraient comparables à celles de la Bolivie, qui jouit des premières réserves mondiales, selon les experts américains.
« Le Japon est le bienvenu pour participer à l’exploration de lithium« , a souligné le président afghan.
« L’Afghanistan doit donner en priorité l’accès aux pays qui l’ont aidé massivement au cours des dernières années« , a-t-il ajouté à l’adresse du deuxième pourvoyeur d’aide à son pays après les Etats-Unis.
Le Japon a promis l’an dernier de verser d’ici 2013 jusqu’à cinq milliards de dollars pour la reconstruction de l’Afghanistan.
Le président afghan a remercié jeudi le nouveau Premier ministre japonais Naoto Kan pour le soutien solide du Japon. Mais Tokyo a insisté sur la nécessité d’une meilleure gouvernance de l’Afghanistan miné par la corruption.



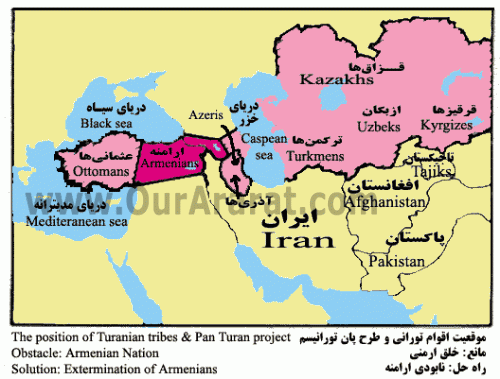

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg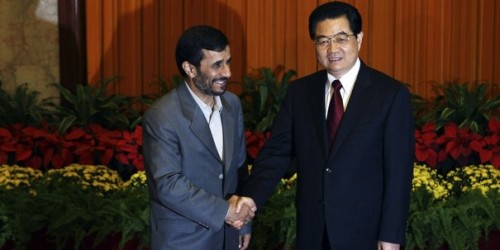












































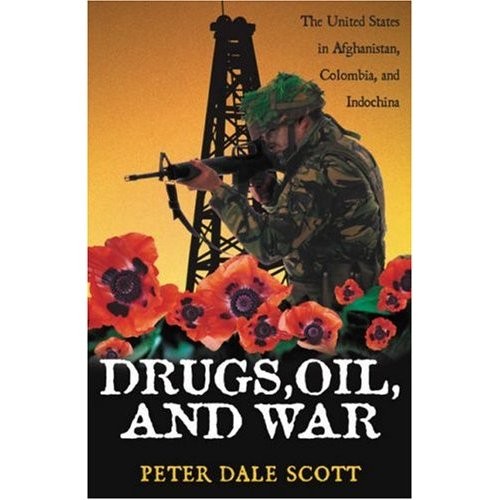 A geopolitical approach aimed at understanding the relationship between the worldwide US strategy and the presence of North American forces in Afghanistan is given. The US penetration in the Eurasian landmass is stressed particularly with regard to the Central Asian area, considered as the underbelly of Eurasia in the context of the US geopolitics. In order to determine the real players in the Afghan theatre, a critics is moved to some general concepts used in geopolitical and international relations studies. The main characteristics
A geopolitical approach aimed at understanding the relationship between the worldwide US strategy and the presence of North American forces in Afghanistan is given. The US penetration in the Eurasian landmass is stressed particularly with regard to the Central Asian area, considered as the underbelly of Eurasia in the context of the US geopolitics. In order to determine the real players in the Afghan theatre, a critics is moved to some general concepts used in geopolitical and international relations studies. The main characteristics

