Dirk Müller, 26.7.2017 - Angriff auf deutsche Autoindustrie – Wie wollen wir künftig Geld verdienen?
https://www.youtube.com/watch?v=fxWiLhROcZ4
Autoindustrie am Abgrund
https://sezession.de/57344/autoindustrie-am-abgrund
Immobilien
US-Investor Blackstone wird größter privater Immobilien-Besitzer Spaniens
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/08/27/us...
EU-Kommission
Wer schützt unsern Obadzda?
https://jungefreiheit.de/kultur/2017/wer-schuetzt-unsern-...
Frankreichs Terror-Fahnder setzen Ermittlungen nach Auto-Attacke fort
Mitten im Ferienmonat August ist Frankreich wieder mit der Terrorgefahr konfrontiert. Warum attackierte ein Mann mit seinem Auto Soldaten in einem Pariser Vorort?
http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Frankreichs-T...
In Polen werden Rufe nach Reparationen aus Deutschland lauter
http://www.focus.de/politik/videos/politisches-erdbeben-i...
Barcelona: Mehrere Tote bei Terroranschlag auf La Rambla
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-08/bar...
Terror in Katalonien
Auch in Cambrils ein Todesopfer
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/terror-in-kata...
Anschlag in Barcelona
Die Bedrohung ist hausgemacht
von Karlheinz Weißmann
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/die-bedro...
Younes Abouyaaquoub
Polizei tötet Hauptverdächtigen des Barcelona-Anschlags
http://www.rp-online.de/panorama/ausland/terror-von-barce...
Hauptverdächtiger ist ein 18jähriger Marokkaner
Messerattacke in Finnland: Polizei sieht terroristischen Vorsatz
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/messerattac...
Schießerei
Tote bei Fluchtversuch in Moskauer Gericht
Ein Fluchtversuch in einem Moskauer Gericht endete für drei Angeklagte tödlich. Die Männer hatten Wachleute angegriffen und ihnen die Waffen entrissen. Dann kam es zu einer Schießerei.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/moskau-schuesse-vor...
(Kein Wort zu den Fahnen und Parolen der linken Gegendemonstranten…)
Nach rechtsextremer Demo
Ausnahmezustand in Charlottesville
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nach-rechtsext...
(Hier sieht man etwas mehr von den Gegendemonstranten, zumindest die rot-schwarz-grüne Fahne der Panafrikanischen Bewegung)
https://www.youtube.com/watch?v=PCXs2l7l2zo
Trumps Reaktion auf Charlottesville
Gegen Gewalt, nicht gegen die Gesinnung
von Thorsten Brückner
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/gegen-gewal...
"#AltLeft"
Trumps Tabubruch
von Michael Paulwitz
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/trumps-ta...
Charlottesville
Michael Moore vergleicht Trump-Wähler mit Vergewaltigern
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/michael-moo...
Sturz eines Konföderierten-Denkmals durch Linksradikale in Durham N.C.
https://www.youtube.com/watch?v=5uZXKOdTjQE
Denkmale: Ein Land im Kunstkrieg
Die USA erleben einen Bildersturm, wie man ihn sonst nur aus Revolutionen kennt. Überall werden unliebsame Denkmale abgeräumt. Muss demnächst auch George Washington dran glauben?
http://www.zeit.de/2017/35/bildersturm-kulturkampf-rassis...
... bringt der Mittelweg den Tod
Ehe das "Attentat" von letztem Samstag vom gestrigen Attentat abgelöst wird, reden wir nochmal politisch. Über Charlottesville.
https://sezession.de/57360/?komplettansicht=1
Politische Korrektheit
Kino in Tennessee nimmt „Vom Winde verweht“ aus dem Programm
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/kino-in-ten...
Trump-Bashing
Provinzielle Hohldreherei
von Michael Paulwitz
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/provinzie...
(London)
Rassismusvorwurf
Linke Journalistin will Nelson-Statue abreißen
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/linke-journ...
Geld für die Türkei
Oettinger fordert weitere Zahlungen für Flüchtlingsdeal
https://www.welt.de/politik/deutschland/article167990198/...
Terrorismus und Islam hängen zusammen
Der Islamgelehrte Kyai Haji Yahya Cholil Staquf ist Generalsekretär der größten Muslim-Vereinigung Indonesiens. Zum islamistischen Terror spricht er Klartext. Der Westen müsse aufhören, Kritik am religiösen Fundament des Extremismus für „islamophob“ zu erklären, sagt er.
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/islamgeleh...
Vietnamesischer Geheimdienst entführt Mann in Berlin
http://www.zeit.de/politik/2017-08/vietnam-berlin-entfueh...
Die Welt hält Kim Jong-un für einen irren Diktator - ein Nordkorea-Experte erklärt, warum das ein schwerer Fehler ist
http://www.huffingtonpost.de/2017/08/11/kim-jong-un-dikta...
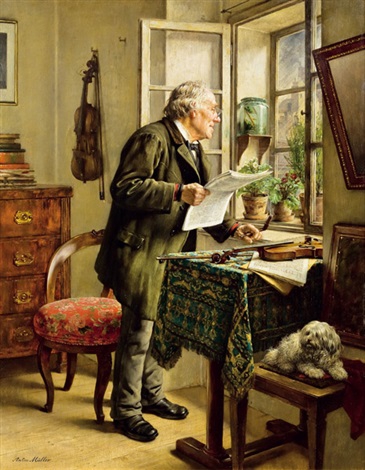
INNENPOLITISCHES / GESELLSCHAFT / VERGANGENHEITSPOLITIK
Raed Saleh
Wenn Begriffe umgedeutet werden
von Thorsten Hinz
https://jungefreiheit.de/kultur/literatur/2017/wenn-begri...
JF-Interview mit Marc Jongen, AfD
„Viel Zeit bleibt Deutschland nicht mehr“
von Moritz Schwarz
https://jungefreiheit.de/allgemein/2017/viel-zeit-bleibt-...
Die historische Bedeutung des 24. Septembers 2017
Ein Weck- und Aufruf zur kommenden Bundestagswahl
http://www.pi-news.net/ein-weck-und-aufruf-zur-kommenden-...
Zahlen und Stimmungen - Zwei Wirklichkeiten
Auf den ersten Blick sehen die Zahlen für Bundeskanzlerin Angela Merkel blendend aus. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass die Stimmung im Land ganz anders sein könnte.
http://cicero.de/innenpolitik/Zahlen-und-Stimmungen-zwei-...
Wahlkampf in Mitteldeutschland
Pfiffe für Merkel
Bundeskanzlerin Merkel ist bei Wahlkampfauftritten in Sachsen und Thüringen von Gegnern lautstark beschimpft worden. In Annaberg-Buchholz störten mehr als 100 Anhänger von Pegida und AfD ihre Rede. In Apolda fiel der Protest nicht ganz so heftig aus.
http://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/merkel-wahlk...
Sanktionen statt Argumente
Lammert fordert Mindeststrafmaß bei Haßkommentaren
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/lammert...
Autoindustrie am Gängelband der Politik
Planwirtschaft läßt grüßen
von Michael Paulwitz
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/planwirts...
(Energiewende 2.0.)
Merkel langfristig für ein Verbot von Verbrennungsmotoren
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diesel-affaere/merk...
Bundesbank schließt Goldverlagerungen vorzeitig ab
http://www.goldseiten.de/artikel/344177--Bundesbank-schli...
Die Stimmung vor der Wahl
Angst vor sozialem Abstieg auf historischem Tiefstand
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/94069...
Polizeistatistik
Deutschlands Hauptbahnhöfe werden immer gefährlicher
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/deutsch...
AfD
Gauland rechtfertigt Kritik an Özoguz
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/gauland...
Entsorgen ist nicht gleich Entsorgen
Von Henryk M. Broder
http://www.achgut.com/artikel/entsorgen_ist_nicht_gleich_...
Antisemiten-Liste
Wiesenthal-Zentrum attackiert Berlins Regierenden Bürgermeister
https://jungefreiheit.de/kultur/2017/wiesenthal-zentrum-a...
Höhere Verteidigungsausgaben
Absurde Argumentation der SPD
Mit dem Hinweis auf die Vergangenheit begründen Martin Schulz und Thomas Oppermann, warum Deutschland seine Zusagen an die Nato brechen müsse. Eine Polemik.
http://www.tagesspiegel.de/politik/hoehere-verteidigungsa...
Hagenow
Bundeswehr prüft Umbenennung der Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/bundesw...
(Fortgesetzter Schuldkult bei der Evangelischen Kirche)
Kirche erinnert an "Darmstädter Wort" zur NS-Zeit
http://www.epd.de/zentralredaktion/epd-zentralredaktion/k...
(Die nächste Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mit Steuergeldern)
4 Millionen Euro für Projekte
NS-Vergangenheit von Kanzleramt und Behörden wird erforscht
https://www.noz.de/deutschland-welt/kultur/artikel/936825...
Auseinandersetzung mit NS-Zeit
70 Jahre Darmstädter Wort: Erinnerungstafel geplant
http://unsere.ekhn.de/detail-unsere-home/news/ankuendigun...
(Berlin)
Umbenennung
Afrikanische Straßennamen fürs Afrikanische Viertel
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/afrikan...

LINKE / KAMPF GEGEN RECHTS / ANTIFASCHISMUS / RECHTE
Innenminister verbietet linksextremistische Internetseite
De Maizière hat die Plattform "linksunten.indymedia.org" verboten. Bei den Betreibern in Freiburg wurden Messer und Schlagstöcke sichergestellt.
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-08/tho...
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/linksunten-indy...
Verbot von „Linksunten.Indymedia“
Blitzmerker im Bundesinnenministerium
von Michael Paulwitz
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/blitzmerk...
Verbot von „Linksunten.Indymedia“
Es war höchste Zeit
von Dieter Stein
https://jungefreiheit.de/debatte/streiflicht/2017/es-war-...
Von Irene Mihilac bis Canan Bayram...
Die grünen Schutzpatronen der Linksfaschisten
http://www.pi-news.net/die-gruenen-schutzpatronen-der-lin...
Autopiloten auf Geisterfahrt
In dem soziologischen Gesetz gefangen, wonach sie angetreten, rennt die Linke zur Zeit ständig gegen die Wand.
https://sezession.de/57365/autopiloten-auf-geisterfahrt
Götz Kubitschek: Eigentlich alles wie im Wendland
Ein Besuch bei Götz Kubitschek, der Rolf Peter Sieferles Buch "Finis Germania" verlegt hat
Von Mariam Lau
http://www.zeit.de/2017/32/goetz-kubitschek-verleger-fini...
Ortsbegehung beantragt
AfD plant offiziellen Besuch der Roten Flora
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article167372196/A...
„Aufstehen gegen Rassismus“
Verfassungsschutz beobachtet Bündnis mit Spitzenpolitikern von SPD und Grünen
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/verfass...
Fragwürdige Bündnispolitik
Auf Kuschelkurs mit Extremisten
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/auf-kusch...
"Aufstehen gegen Rassismus"
Im Kampf gegen die AfD sind auch gewaltbereite Extremisten willkommen
von Felix Krautkrämer
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/im-kamp...
Kampf gegen die AfD
„Es wird in diesem Konflikt Opfer geben“
von Felix Krautkrämer
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/es-wird...
(Hass gegen den Hass…)
Warnung vor AfD
Amadeu-Antonio-Stiftung: Der Haß zieht in den Bundestag
https://jungefreiheit.de/allgemein/2017/amadeu-antonio-st...
Rechtswidrige Hausdurchsuchung
Bayerns AfD-Chef beklagt Wahlbehinderung
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/bayerns...
Die Trümmer der AfD-Plakate
von Dieter Stein
https://jungefreiheit.de/debatte/streiflicht/2017/die-tru...
Bikini statt Burka
Gleichstellungsbeauftragte will AfD-Plakat verbieten
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/gleichs...
Gegen AfD und Rechtsruck
Linksextremes Antifa-Camp in Baden-Württemberg
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/linksex...
AfD-Anfrage
Mecklenburg-Vorpommern subventioniert Doku über linksradikale Band
https://jungefreiheit.de/kultur/2017/mecklenburg-vorpomme...
Fall in Mühldorf
Flüchtlingshelferin startet Petition gegen AfD-Sachbearbeiter
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/fluecht...
Scheibe an Auto von Spandauer AfD-Chef Otti eingeschlagen
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article21...
Gewalt gegen die AfD
Düsseldorfer Wirte schließen aus Angst vor Linksextremisten
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/duessel...
Perleberg/Wittenberge
Wahlplakate abgerissen: AfD erstattet Anzeige
http://www.maz-online.de/Lokales/Prignitz/Wahlplakate-abg...
Berlin
AfD-Plakate abgerissen, Angriff auf Pro Deutschland-Helfer
Ein 28-Jähriger hat Wahlplakate der AfD von Laternen gerissen. Zuvor war ein Wahlhelfer von Pro Deutschland attackiert worden.
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article20...
Hannover
Angriff auf Gauland-Auftritt: Randalierer reißt Rednerpult von AfD-Bühne + Video
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/angriff-auf-...
(…ein alt gewordener Schwarzer Block…)
Wahlkampfveranstaltung mit AfD-Prominenz
Großes Polizeiaufgebot und friedlicher Protest gegen Petry
https://www.op-online.de/region/neu-isenburg/friedlicher-...
Sachsen-Anhalt
CDU unterstützt AfD-Antrag und erntet Kritik von anderen Parteien
http://www.focus.de/politik/deutschland/sachsen-anhalt-cd...
Vorlesetag
Gefährliche Vorleser
von Felix Krautkrämer
https://jungefreiheit.de/kultur/2017/gefaehrliche-vorleser/
(Dazu…)
Bundesweiter Vorlesetag
Von Iris Nieland
https://irisnieland.wordpress.com/2017/08/18/bundesweiter...
"Autoritär und nationenbezogen"
Linken-Politikerin deutet SED zur Rechtspartei um
von Felix Krautkrämer
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/linken-...
(Wahlkampf der "Linken")
Aufgeschnappt
„Nazis, überall Nazis!“
von Matthias Bäkermann
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/nazis-u...
(Freunde im Geiste)
Jusos warnen vor Kriminalisierung von Linksextremisten
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/jusos-w...
(Verharmlosende Sozialdemokraten)
Gabriel: „Linke und rechte Gewalt nicht identisch“
Union wirft Gabriel Verharmlosung linker Gewalt vor
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/union-w...
(Ein "Grünen"-Politiker fordert Zensur gegen Konservative…)
Vorwurf Volksverhetzung
Bei Nebenwirkungen verschließen Sie die Augen oder rufen Sie den Staatsanwalt
von Felix Krautkrämer
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/bei-neben...
Besetzte Teppichfabrik
„Vollidioten mit Nietenarmband und Bierflasche“
von Felix Krautkrämer
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/vollidi...
G20-Krawalle: Polizei ermittelt in über 2.000 Fällen
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/g20-kra...
Urteil nach G-20-Krawallen
Polizisten sind kein Freiwild für erlebnisorientierte Gewalttäter
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article168086948/P...
Ein Überblick
Die Kämpfe der linken Szene in Frankfurt
Die Eskalation der Gewalt beim G 20-Gipfel in Hamburg hat die linke Szene in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. In den vergangenen Jahren machten radikale Gruppen und Bündnisse in der Stadt mehrfach auf sich aufmerksam – mitunter auch mit gewaltsamen Aktionen. http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Die-Kaempfe-der-linke...
Kampf gegen Rechts
Berliner AfD beklagt Förderung linker Organisationen
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/berline...
Bundestagswahl
CDU-Spitzenkandidat will Förderung linker Vereine prüfen
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/cdu-spi...
Nach Brandanschlägen auf Bahn
Neonazis stranden und wüten in Kleinstadt
https://www.welt.de/vermischtes/article167826937/Neonazis...
(Hier greift die deutsche Justiz mal durch…)
Überfall auf Döner-Laden: Drei Männer müssen ins Gefängnis
Das Landgericht München II hat acht Männer verurteilt, die einen ausländerfeindlichen Anschlag auf einen Döner-Laden verübt haben. Bewaffnet hatten sie Ausländern hinterhergejagt.
http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Ueberfall-auf-...
Wegen Verteilaktion
Hausdurchsuchung bei Berliner Identitären-Chef
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/hausdur...
Hausdurchsuchung bei IB-Chef
Im Visier des Maßnahmenstaats
von Thorsten Hinz
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/im-visier...
"Ein Prozent" im Fadenkreuz – Anschläge in Halle
https://sezession.de/57357/%22ein-prozent%22-im-fadenkreu...
AfD Hessen Hauskauf für die Identitären
AfD-Kandidat Andreas Lichert half Rechtsextremen beim Erwerb einer Immobilie in Halle. Es gab eine offene Zusammenarbeit in der „Ein-Prozent-Initiative“.
http://www.fr.de/rhein-main/afd-hessen-hauskauf-fuer-die-...
So eng arbeiten AfD-Politiker und Neonazis inzwischen zusammen
http://www.bento.de/politik/afd-und-rechtsextreme-identit...
(Der Rheinischen Post ist die Tat weniger wichtig als die scheinbaren Verbindungen des Opfers)
Nach Attacke in Bochum
Gewalttat gegen AfDler zeigt Verbindung der AfD-Jugend zu "Identitärer Bewegung"
http://www.rp-online.de/nrw/landespolitik/gewalttat-gegen...
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3707922
Stand der Dinge: Mittelmeer und Notaufnahme
Während mutmaßliche Linksextreme in Bochum ein Mitglied der Jungen Alternative in die Notaufnahme geprügelt haben, meldet die Crew von #DefendEurope: "Mission erfüllt!" Hier ist die aktuelle Lage
https://sezession.de/57366/stand-der-dinge:-mittelmeer-un...
Wegen Verbreitung wahrer Tatsachen
Sechs Monate Haft für PI-NEWS Autor Michael Stürzenberger
http://www.pi-news.net/eilt-sechs-monate-haft-fuer-pi-new...
Eine Gegenerklärung
von Caroline Sommerfeld
... zur "Erklärung der Waldorfschulen gegen Rassismus und Diskriminierung". Wenn Waldorfschulen sich von den Ideen Rudolf Steiner distanzieren, wird es eng für die Freiheit des Geisteslebens und ihrer Mitglieder.
https://sezession.de/57363/?komplettansicht=1
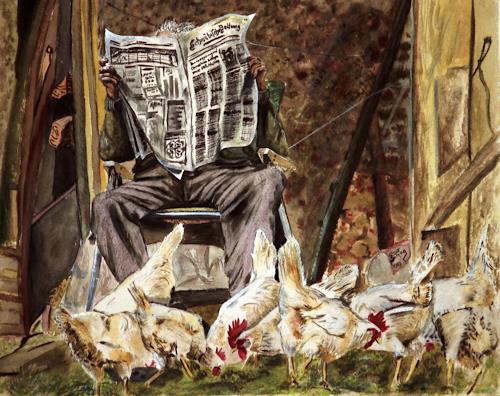
EINWANDERUNG / MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT
DefendEurope – Interview mit Simon Kaupert
Ganz Europa schaut dieser Tage Richtung Mittelmeer. Die einen beten, daß der ganz große Ansturm bis zur Wahl ausbleibt, die anderen hoffen auf eine Verschärfung der Asyldebatte und grundsätzliche Entscheidungen.
https://sezession.de/57345/#defendeurope-%E2%80%93-interv...
Interview zu „Defend Europe“
„Wir tun das, was eigentlich Aufgabe der Regierung wäre“
von Lukas Steinwandter
https://jungefreiheit.de/debatte/interview/2017/wir-tun-d...
(Zum Schlepper-Unwesen der so genannten Hilfsorganisationen)
Die Mittelmeer-NGOs
Gastbeitrag von Simon Kaupert -- Das Mittelmeer ist das Einfallstor nach Europa.
https://sezession.de/57351/die-mittelmeer-ngos-i
14 Tage Defend Europe - Albtraum der NGOs! Identitäre mit C-Star im Mittelmeer
https://www.youtube.com/watch?v=0lCGHo7qI9I
Ein Meer wird geschlossen
Wendepunkt im Mittelmeer: Italienische Schiffe dürfen in libyschen Hoheitsgewässern operieren – und Migranten zur libysche Küste zurückbringen. Paris wird in Libyen Aufnahmezentren einrichten. Vor dem Ende systematischer Personenkontrollen.
https://www.bayernkurier.de/ausland/27308-ein-meer-wird-g...
Italienische Küstenwache setzt deutsches NGO-Schiff fest
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/italienisch...
(C-Star)
Eine Nachricht an die Behörden von Malta
Das ist eine Nachricht der C-Star an die Behörden von Malta
https://de-de.facebook.com/DefendEuropeID/posts/170375463...
(C-Star)
Defend Europe: Pressekonferenz zum Ausgang der Mission
https://www.youtube.com/watch?v=y5FE6nlCqnM
(C-Star)
Eine neue Odysee
Von Martin Sellner
https://www.youtube.com/watch?v=DoEE9EEya_A
Eine Woche Heldenschmiede
von Till-Lucas Wessels
Hier mein Bericht von der Sommeruniversität der französischen Génération Identitaire
https://sezession.de/57368/eine-woche-heldenschmiede-(25)
Rom
Einwanderer liefern sich Straßenschlachten mit Polizei
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/einwanderer...
Geldflüsse in Entwicklungsländer
Private Überweisungen: „Migration fördert Migration“
https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2017/volkswirt-ueber-...
Asylpolitik
Bericht: 390.000 Syrer haben Anrecht auf Familiennachzug
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/bericht...
Die Mehrheit möchte das nicht
Was Özoguz will
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/w...
Streit um Integrationsbeauftragte
AfD: Özoguz ist „Schandfleck der Bundesregierung“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/afd-oez...
(Integration I…)
Integration sei gefährdet
„Stoßen an Grenzen“: Kommunen fordern Stopp der Flüchtlingsverteilung
https://www.merkur.de/politik/stossen-an-grenzen-kommunen...
(Integration II…)
Integriert und radikalisiert
Das unglaubliche Doppelleben der jungen Attentäter
https://www.welt.de/politik/ausland/article167850496/Das-...
Möglichst exotisch
Eine Analyse zur so genannten ehrenamtlichen "Flüchtlingshilfe"
http://bff-frankfurt.de/artikel/index.php?id=1208
Cádiz
Illegale Einwanderer stürmen spanischen Strand
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/illegale-ei...
Merkel weiter gegen Obergrenze
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/merkel-...
Deutschland schiebt weniger Ausländer ab
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/deutsch...
Erstmals seit zwei Jahren
Asylbehörde schickt Familien wieder nach Italien zurück
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/asylbeh...
Abgelehnte Flüchtlinge berichten über ihre Flucht
Bei Abschiebung warten die Taliban
https://www.op-online.de/offenbach/abgelehnte-fluechtling...
(dazu…)
Jugendliche Flüchtlinge aus Afghanistan in Offenbach
Petition und Demo gegen Abschiebung
https://www.op-online.de/offenbach/jugendliche-fluechtlin...
(Hier warten die Taliban aber offenbar nicht…)
Baden-Württemberg
Asylbewerber machen Urlaub im Heimatland
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/asylbew...
Integrationsbeauftragte
Özoguz rechtfertigt Heimatreisen von Asylbewerbern
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/oezoguz...
Einwanderung nach Quebec
Wegen Trump: Flüchtlinge fliehen aus den USA nach Kanada
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/wegen-trump...
Kanzleramtschef Altmaier verteidigt Grenzöffnung
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/kanzler...
Flüchtlingskrise
Juso-Chefin träumt von einer Welt ohne Grenzen
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/juso-ch...
Helferin deckt auf:
Was Flüchtlinge wirklich über uns reden
http://www.krone.at/oesterreich/was-fluechtlinge-wirklich...
(unglaublich neue Erkenntnisse…)
Gesundheitsamt stellt bei Erstklässlern bedenkliche Mängel fest
„Zu dick und zu schlechte Deutschkenntnisse“
https://www.op-online.de/leben/einschulung-region-ere3844...
(Asylbewerber von "Sugar Mamas" sexuell ausgenutzt?)
Flüchtlinge als Sexmaschinen? Reife Frauen halten sich Männer
https://www.tag24.de/nachrichten/krise-oesterreich-fluech...
Begleitung von Asylbewerbern
Flüchtlingsorganisationen weisen Betrugsvorwurf zurück
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/fluecht...
Medikament gegen Haß
Refugees Welcome – jetzt auch auf Rezept
von Thorsten Brückner
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/refugees-...
(Türkische Gemeinde; auch hier könnte man Oxytocin verabreichen)
Bundestagswahl
„In unseren Zukunftsvisionen für Deutschland hat die AfD keinen Platz“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/in-unse...
„Germanys Muslims“: Muslime in Rocker-Kutten gründen Bürgerwehr in NRW
https://www.derwesten.de/staedte/duisburg/germanys-muslim...
(Eine journalistische Meisterleistung von dpa, in diesem Artikel kein Wort zu den Ursachen und der Herkunft der Täter zu verlieren)
Problem: Mangelnder Respekt Gewalt gegen Beamte und Staatsbedienstete nimmt zu
http://www.fnp.de/rhein-main/Gewalt-gegen-Beamte-und-Staa...
Hamburg
„Gefährliche Situation“ JVA-Beamte konnten die wütende Menge kaum bändigen
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article167661309/J...
Skandal in Großbritannien Bande zwang Mädchen jahrelang zu Sexpartys – Hunderte Opfer
https://www.welt.de/vermischtes/article167550016/Bande-zw...
http://www.bbc.com/news/uk-england-40879427
Kommentar zum Attentat von Hamburg
Niemand will’s gewesen sein
von Felix Krautkrämer
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/niemand-w...
Landfriedensbruch
Ausländer liefern sich Massenschlägerei in Dresden
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/auslaen...
https://www.tag24.de/nachrichten/70-personen-massenschlae...
Papenburg
Asylbewerber kneift Mädchen in die Brust
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/asylbew...
(einer der Täter hatte "schwarze Haare"…)
Polizei sucht Zeugen
Unbekannte schlagen Obdachlosen in U-Bahnhof Mehringdamm
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/polizei-suc...
Obdachlosen von Bank geprügelt - Täter stellen sich
Vier Jugendliche prügeln am U-Bahnhof Mehringamm auf einen Obdachlosen ein. Drei Verdächtige stellten sich jetzt der Polizei.
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article21...
Pfaffenberg
Krawalle im Rahmen des Volksfestes
http://www.idowa.de/inhalt.pfaffenberg-krawalle-im-rahmen...
Männer überfallen Essenerin (25) von hinten und drücken sie auf den Boden
https://www.derwesten.de/staedte/essen/maenner-ueberfalle...
Karlsruhe
Brutale Messerattacke auf Fahrgast löst Panik im ICE aus!
https://www.karlsruhe-insider.de/news/mann-attackiert-fah...
Frankfurt/Oder
Asylbewerber prügeln auf Passanten ein
http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1594560
Filderstadt
16-jähriges Mädchen beleidigt und begrapscht
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.filderstadt-...
Augsburg / Bobingen
28-Jähriger belästigt Frauen und verletzt 41-Jährige mit Messer
http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/28-Jaehriger...
Erding
Afghane (22) bedrängt nachts junge Erdingerin – Flucht vereitelt
Sex-Attacke am S-Bahnhof
https://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/afgh...
12-Jährige auf der Spielwiese in Gera sexuell belästigt – Zeugen gesucht
http://www.otz.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specif...
Oberottmarshausen | Flirtversuch unterbunden – Zurückgewiesener zieht Pistole
https://presse-augsburg.de/presse/oberottmarshausen-flirt...
23-Jährige in Niebüll vergewaltigt
http://www.kn-online.de/News/Aktuelle-Nachrichten-Schlesw...
Linz: Messer-Afghane beraubt mit offener Hose Passanten!
https://www.wochenblick.at/linz-messer-afghane-beraubt-mi...
Wuppertal: Mann beim Spazierengehen bewusstlos geschlagen
http://www.freiezeiten.net/wuppertal-mann-beim-spaziereng...
Polizeidirektion Hannover
POL-H: Duo überfällt 39-Jährigen auf Toilette für Schwerbehinderte - Die Polizei sucht Zeugen!
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3701280
(Kongolese in Karlsruhe)
Eskalation im Supermarkt: Psychisch Kranker attackiert Kunden und Polizisten
https://www.karlsruhe-insider.de/news/eskalation-in-super...
Stuttgart
Brutaler Raub auf der Königstraße
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stuttgart-br...
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Mann mit Messer durch Bundespolizisten überwältigt
https://amp.focus.de/regional/nordrhein-westfalen/bundesp...
Kaufland in Papenburg
Mann begrapscht Kind, klaut Waren und prügelt Polizisten
https://www.nwzonline.de/blaulicht/papenburg-kaufland-in-...
„King Abode“
Bautzen: Problem-Libyer erhält Aufenthaltsverbot
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/bautzen...
Plauen
Diebstähle und Sex-Attacken
Sächsisches Kulturzentrum verhängt Disko-Verbot für Asylbewerber
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/saechsi...
Wilnsdorf
Gruppen-Grapscher bedrängen 17jährige
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/gruppen...
https://www.welt.de/vermischtes/article167849189/17-Jaehr...
Nachts in einem Münchner Park
Afghane vergewaltigt 17-Jährige - Warnschuss durch Polizei!
https://www.rosenheim24.de/bayern/muenchen-sexueller-uebe...
(Araber)
Kaprun: Faustschläge nach Fotostopp auf Rodelbahn
https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaprun-faustschlaeg...
Düsseldorf
Kein Disko-Zutritt: Bis zu 300 Einwanderer gehen auf Polizisten los
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/kein-di...

KULTUR / UMWELT / ZEITGEIST / SONSTIGES
(Altstadtzerstörung durch Bauwahn)
Denkmalschutz: Viechtach - wie eine Stadt verschwindet
https://www.youtube.com/watch?v=KX6AJsUx-MM
Trotz Denkmalschutz: Und wieder stirbt ein Stück München!
https://www.tz.de/muenchen/stadt/au-haidhausen-ort43334/t...
(Hocktoilette in Köln)
Politische Korrektheit
„Nach Mekka kacken geht gar nicht“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/nach-me...
Holländische Bahn führt geschlechtsneutrale Anrede ein
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/hollaendisc...
Politische Korrektheit
Sexismus-Vorwürfe: Hochschule stört sich an Liebesgedicht
https://jungefreiheit.de/kultur/2017/sexismus-vorwuerfe-h...
https://www.welt.de/kultur/article168129647/Wie-sexistisc...
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/asta...
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/frauen-be...
Straftaten in Deutschland
Gewalt gegen Homosexuelle nimmt stark zu
https://www.nzz.ch/international/straftaten-in-deutschlan...
"Handschrift ist Hirnschrift"
Viele Schüler haben Probleme mit der Handschrift. Sie – wie auch viele Erwachsene – tippen meist auf Computer-Tastaturen. Doch Pädagogen warnen vor einem Ende des Handschreibens.
https://plus.pnp.de/ueberregional/die_seite_3/2604749_Han...
WDR-Journalistin für Wahrheit bestraft: „Meine journalistische Karriere in Deutschland ist zu Ende“
Es war ein ehrlicher Satz, der ihr die berufliche Zukunft nahm: "Bei Sendern und Verlagen ist meine journalistische Karriere in Deutschland nach dieser Äußerung zu Ende", sagt Claudia Zimmermann, die seit eineinhalb Jahren keinen Auftrag mehr bekommt.
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/staats-tv-co...
(Fake News)
Falsche Berichte
Bundesregierung: Keine Beteiligung von Rechtsradikalen bei G20-Randale
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/bundesr...
(Zu Andreas Scheffel, Urheber der Behauptung und Kämpfer gegen rechts)
http://www.beobachternews.de/2017/02/04/bedrohter-journal...
Grüne gründen „Netzfeuerwehr“ gegen Fake-News
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/gruene-...
Anti-Diversity-Papier
Google feuert Mitarbeiter nach Kritik an Gender-Förderung
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/google-...
Google
Entlassen wegen kritischen Denkens
von Lukas Mihr
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/entlassen...
Netzwerkdurchsetzungsgesetz
Facebook baut zweites Löschzentrum in Deutschland auf
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/faceboo...
Fake News „C-Star“ in Seenot
Verfrühte Schadenfreude
von Michael Paulwitz
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/verfrueht...
Lügenpresse-Vorwurf
Zwei Versionen einer Spuckattacke
von Thorsten Brückner
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/zwei-vers...
«Vielleicht müssen wir all das erdulden»
Interview
Der britische Autor Douglas Murray über Europas geistige Krise, Angela Merkels Tragik und die Sonderstellung des Islam unter den Religionen.
https://mobile2.bazonline.ch/articles/598981c9ab5c3728860...
Wegen Nacktheit
Der Punk starb in Potsdam
von Felix Krautkrämer
https://jungefreiheit.de/kultur/2017/der-punk-starb-in-po...
https://spartacus-potsdam.de/news/news.php?ID=637
Es ist Magie! 10.000 Seiten uralter Zaubersprüche entdeckt
Verstaubt in der Unibibliothek, Jahrhunderte alt: In Leipzig ist eine einzigartige Ritualsammlung aufgetaucht. Geister beschwören, sich unsichtbar machen – so geht's.
http://www.zeit.de/wissen/geschichte/2017-08/magie-zauber...
Gefährlicher Strand-Fund: Vermeintlicher Bernstein entzündet sich
Dieser Fund hätte einer 41-jährigen Frau zum Verhängnis werden können: Der vermeintliche Bernstein war ein Phosphor-Klumpen. Die gefährliche Chemikalie entzündete sich und setzte ihre Jacke in Brand.
http://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Gefae...
Attraktivität der RAF
Was Militanz und „direkte Aktion“ so reizvoll macht
https://www.welt.de/geschichte/raf/article168089386/Was-M...
"Systemfehler" als Urlaubslektüre
https://sezession.de/57346/%C2%BBsystemfehler%C2%AB-als-u...
(Buch "Kontrollverlust")
Spiegel-Bestsellerautor Thorsten Schulte im Fadenkreuz von Justiz und Polizei. Weckruf!
https://www.youtube.com/watch?v=Hb5vS_kQhJs
Nothing to do with Islam - Official Music Video
https://www.youtube.com/watch?v=udQGMi2oook






 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg


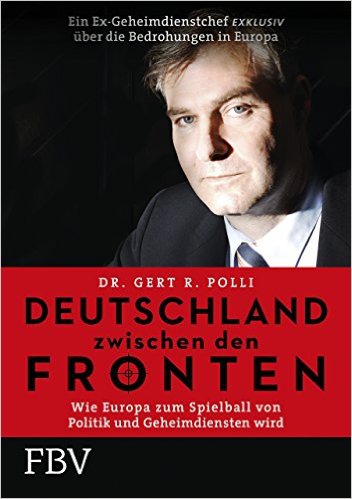





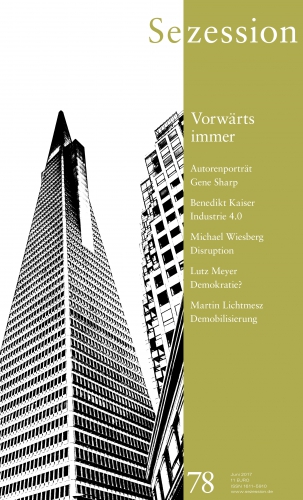



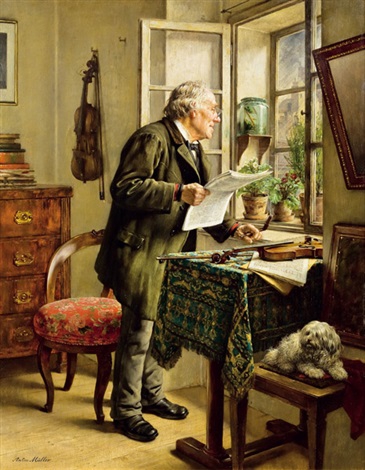

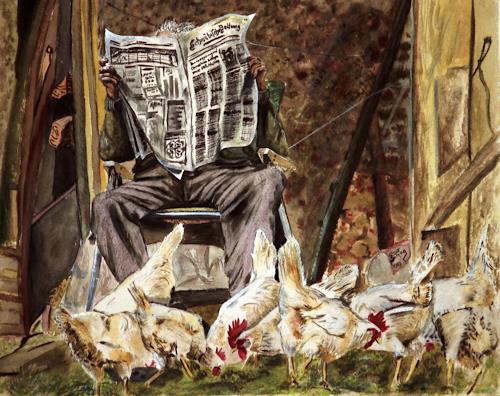

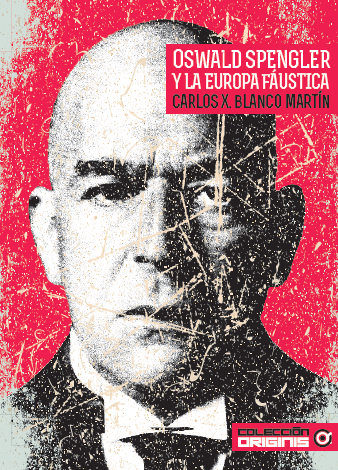

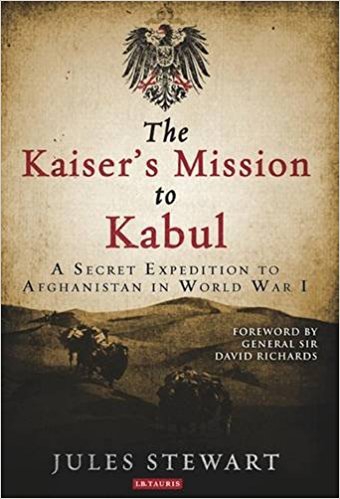 Jules Stewart,
Jules Stewart,


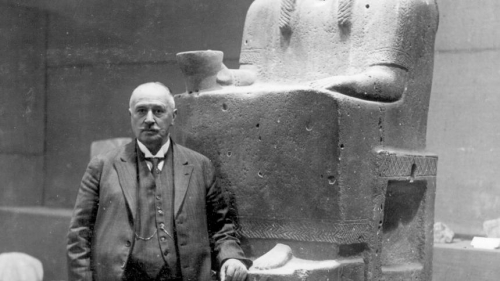
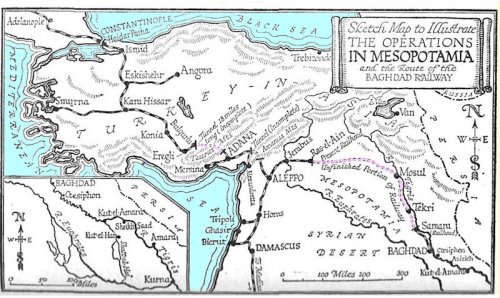
 En Afghanistan, à l’époque, règne le roi Habiboullah, une forte personnalité. Il est pro-britannique, moderniste sur le plan des mœurs et par son féminisme qui ouvre des écoles pour les filles. Il s’habille à l’occidentale et assure la modernisation de son pays. Il n’a jamais quitté l’Afghanistan. Il n’est pas sur la même longueur d’onde que son frère Nasroullah qui est tout à la fois moderniste (mais sur le seul plan technique, non sur les moeurs) et islamiste, alors qu’il a souvent voyagé à l’étranger. Nasroullah est pro-allemand. Le principal intellectuel du royaume d’Afghanistan est le journaliste Mahmoud Tarzi, adepte d’un « nationalisme islamique ». De 1910 à 1914, les zones tribales de l’actuel Pakistan sont en ébullition : la répression britannique est sévère. Les Pachtounes afghans veulent porter secours à leurs frères de race et se mettent en mouvement en direction de la frontière. Nasroullah fait distribuer 5000 fusils et 500.000 cartouches aux guerriers tribaux pachtounes. Habiboullah réagit très rapidement et promet de punir avec la plus extrême sévérité tous ceux qui entendent attaquer les Indes britanniques. Habiboullah réclame, devant l’assemblée venue l’écouter alors que les Pachtounes appellent au djihad contre les Anglais, qu’on lui apporte un Coran ; il met ses contradicteurs au défi « de trouver un verset ou un chapitre du Coran qui appelle au djihad contre ses amis » (Stewart, p. 24). « Il menaça alors d’arracher la langue à tous ceux qui oseraient encore appeler au djihad et de faire trancher les pieds de ceux qui seraient surpris à marcher vers les zones de combat » (ibid.).
En Afghanistan, à l’époque, règne le roi Habiboullah, une forte personnalité. Il est pro-britannique, moderniste sur le plan des mœurs et par son féminisme qui ouvre des écoles pour les filles. Il s’habille à l’occidentale et assure la modernisation de son pays. Il n’a jamais quitté l’Afghanistan. Il n’est pas sur la même longueur d’onde que son frère Nasroullah qui est tout à la fois moderniste (mais sur le seul plan technique, non sur les moeurs) et islamiste, alors qu’il a souvent voyagé à l’étranger. Nasroullah est pro-allemand. Le principal intellectuel du royaume d’Afghanistan est le journaliste Mahmoud Tarzi, adepte d’un « nationalisme islamique ». De 1910 à 1914, les zones tribales de l’actuel Pakistan sont en ébullition : la répression britannique est sévère. Les Pachtounes afghans veulent porter secours à leurs frères de race et se mettent en mouvement en direction de la frontière. Nasroullah fait distribuer 5000 fusils et 500.000 cartouches aux guerriers tribaux pachtounes. Habiboullah réagit très rapidement et promet de punir avec la plus extrême sévérité tous ceux qui entendent attaquer les Indes britanniques. Habiboullah réclame, devant l’assemblée venue l’écouter alors que les Pachtounes appellent au djihad contre les Anglais, qu’on lui apporte un Coran ; il met ses contradicteurs au défi « de trouver un verset ou un chapitre du Coran qui appelle au djihad contre ses amis » (Stewart, p. 24). « Il menaça alors d’arracher la langue à tous ceux qui oseraient encore appeler au djihad et de faire trancher les pieds de ceux qui seraient surpris à marcher vers les zones de combat » (ibid.). 



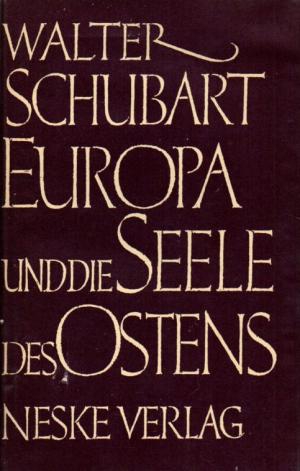 Like the optimism of the Victorians (or at least the strata that did not live in squalor) during the Industrial Revolution, with their Darwinism, the West is supposedly continuing to march forward in progress as the epitome of human ascent, toward which all that has gone before was merely a prelude. In this scenario, we are about to enter a dispensation that will “end history,” as Professor Francis Fukuyama put it, (F. Fukuyama, “The End of History?,” The National Interest, Summer 1989,
Like the optimism of the Victorians (or at least the strata that did not live in squalor) during the Industrial Revolution, with their Darwinism, the West is supposedly continuing to march forward in progress as the epitome of human ascent, toward which all that has gone before was merely a prelude. In this scenario, we are about to enter a dispensation that will “end history,” as Professor Francis Fukuyama put it, (F. Fukuyama, “The End of History?,” The National Interest, Summer 1989, 
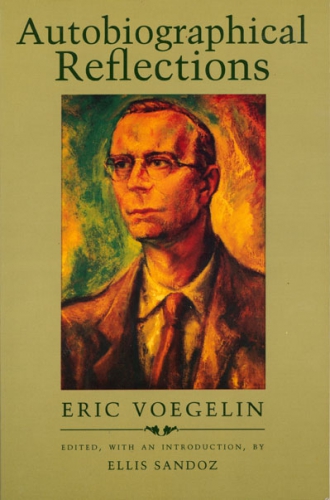

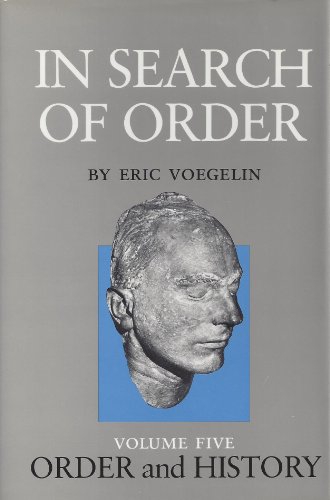
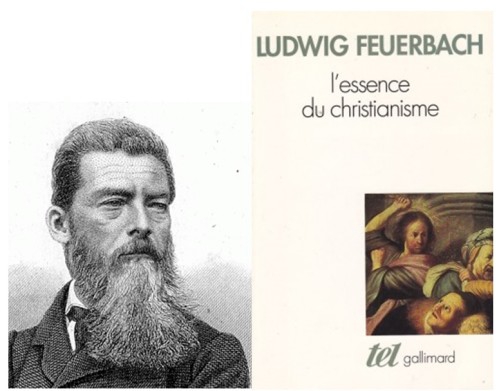
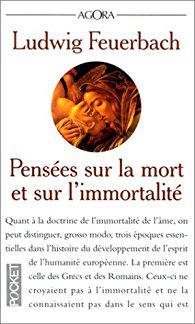 « J’ai déclaré par conséquent que, pour trouver dans le christianisme un digne objet d’étude, j’avais été obligé de faire abstraction du christianisme moderne, dissolu, confortable, épicurien, coquet et sans caractère, et de me reporter dans ces temps où la fiancée du Christ, vierge encore, chaste et pure, n’avait pas mêlé à la couronne d’épines de son fiancé céleste les roses et les myrtes de la Vénus païenne, dans ces temps où, pauvre en vérité des trésors de la terre, elle était riche et heureuse dans la jouissance des mystères d’un amour surnaturel. »
« J’ai déclaré par conséquent que, pour trouver dans le christianisme un digne objet d’étude, j’avais été obligé de faire abstraction du christianisme moderne, dissolu, confortable, épicurien, coquet et sans caractère, et de me reporter dans ces temps où la fiancée du Christ, vierge encore, chaste et pure, n’avait pas mêlé à la couronne d’épines de son fiancé céleste les roses et les myrtes de la Vénus païenne, dans ces temps où, pauvre en vérité des trésors de la terre, elle était riche et heureuse dans la jouissance des mystères d’un amour surnaturel. »
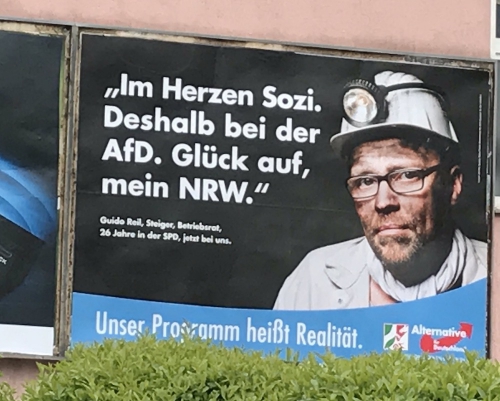
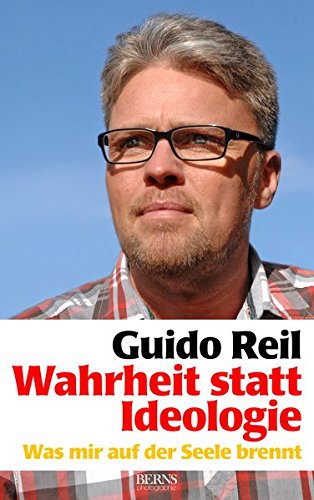

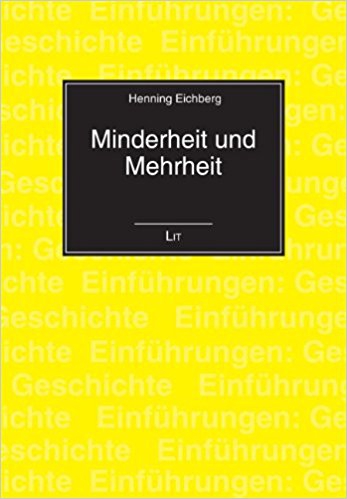
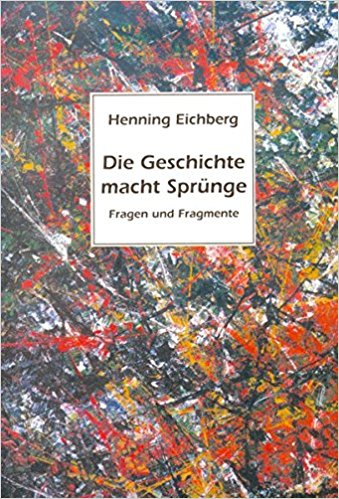
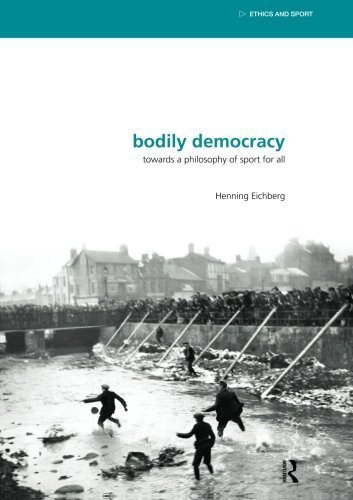

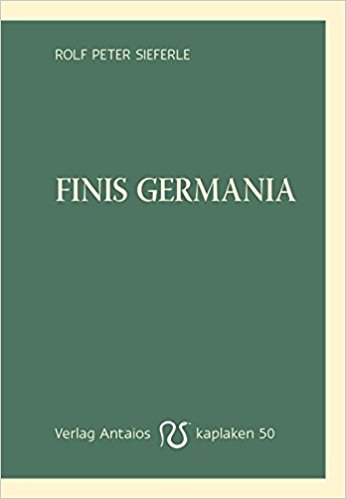
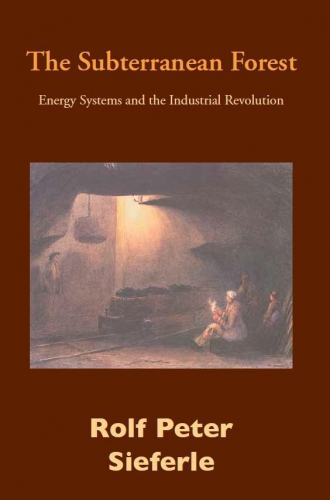
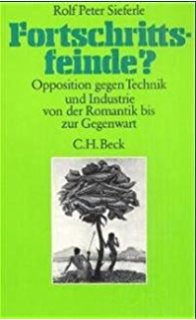
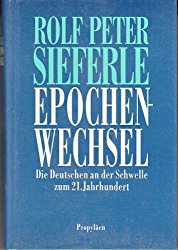
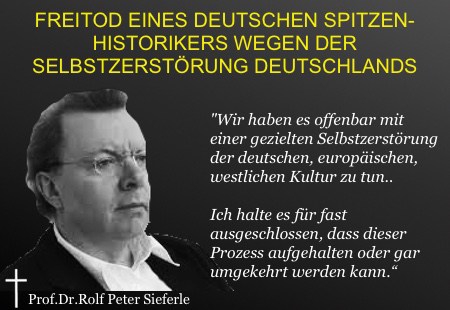
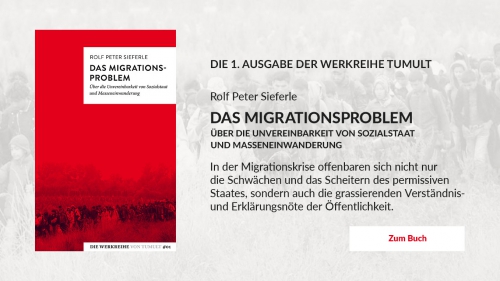




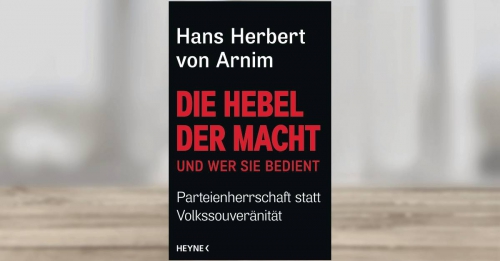
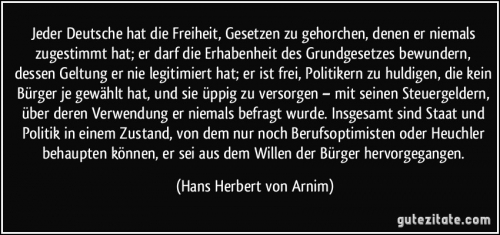

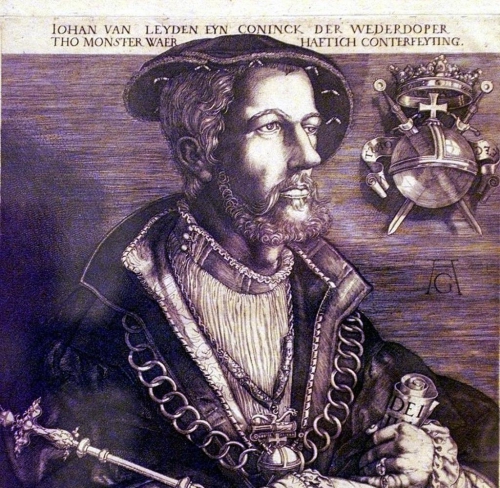






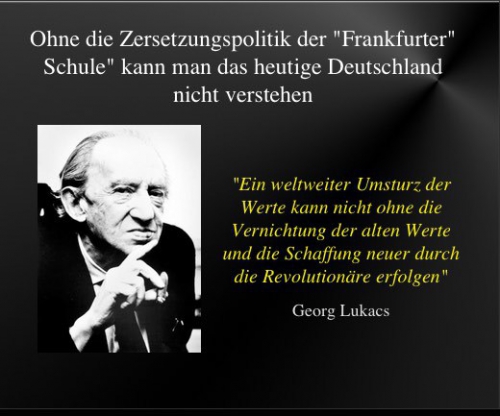
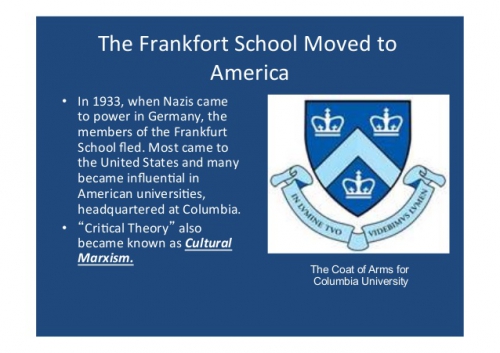

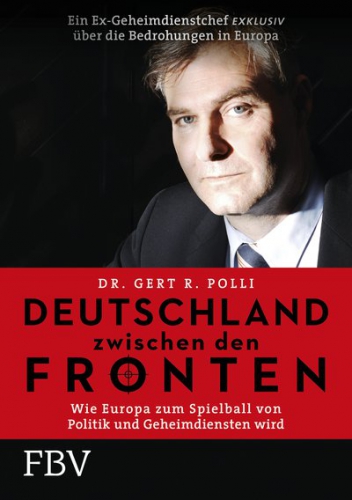

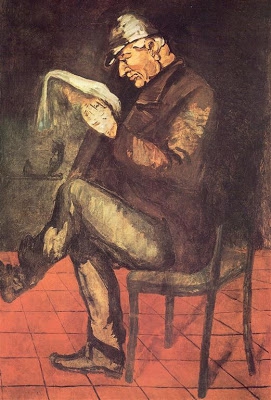
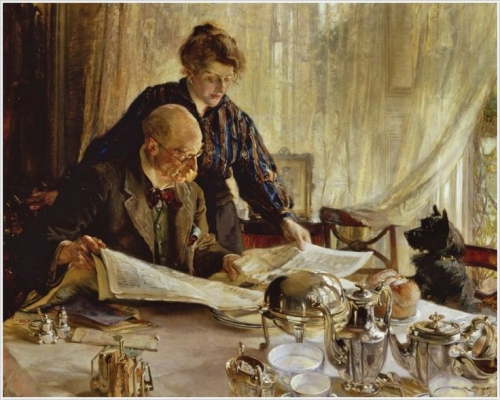
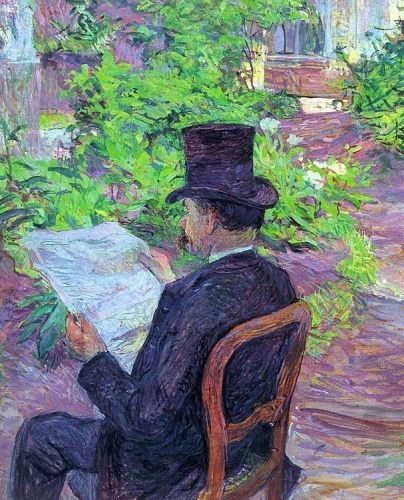
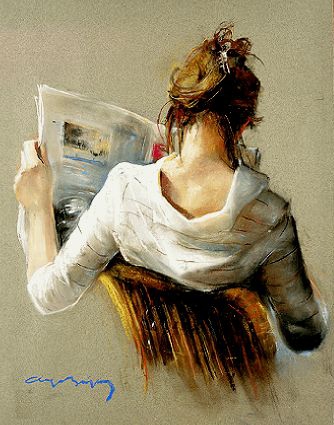
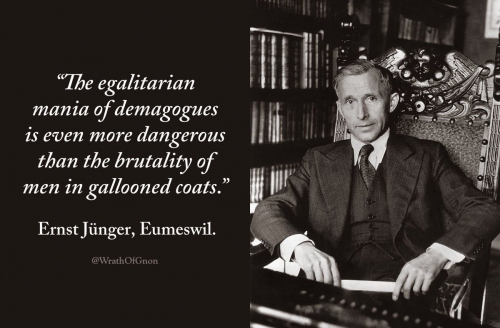
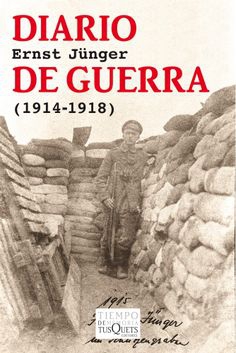 ¿Quienes provocan esa catástrofe? Expeditiva e incompleta será la respuesta que cite al Gran Guardabosque. En principio, su arquetipo es el del "gran bárbaro". Hombre de guerra, reclutador de la peor canalla, todo le es válido con tal de arrasar y dar satisfacción a sus ambiciones. A las mientes nos vienen Atila, Gengis Khan, Almanzor, Hitler, Stalin... El Gran Guardabosque se va acercando al país dulce, de clima bondadoso, de refinada cultura clásica, de límpidas y gratas costumbres, La Marina. Cuanto se ve desde La Marina parece una síntesis geográfica e histórica. Como en los sueños, desde los Acantilados de Mármol se divisa una condensación de tiempos y paisajes. Se perciben valores y hábitos de tiempos medievales, la persistencia de códigos caballerescos, monacales, campesinos, etc. de aquellos siglos lejanos, en unión onírica con elementos propios de la contemporaneidad (automóviles, por ejemplo). La Marina recuerda la Europa mediterránea y templada, el entorno de países con fuerte cultura clásica, países de ricos viñedos y tradiciones hermosas. Por el contrario, el Gran Guardabosque representa la zafiedad de quien procede de brumosos y oscuros bosques, prototipo del bárbaro, al que unos climas y territorios poco amables no pueden afectarle de otro modo sino por embrutecimiento. Sin embargo, la figura del Gran Guardabosque es muy compleja en esta obra de Jünger. No es el "bruto", no carece de cierta grandeza, pese a que su acción sobre la Civilización será nefasta. Los personajes que de todo punto repugnan son los que les siguen, aquellos a quienes sus tropas reclutan y movilizan. La canalla, la hez, aquellos que conforman –en toda civilización o comunidad gastada- la Oclocracia. Tras Aristóteles, las descripciones spenglerianas de la Oclocracia nos parecen aquí fundamentales.
¿Quienes provocan esa catástrofe? Expeditiva e incompleta será la respuesta que cite al Gran Guardabosque. En principio, su arquetipo es el del "gran bárbaro". Hombre de guerra, reclutador de la peor canalla, todo le es válido con tal de arrasar y dar satisfacción a sus ambiciones. A las mientes nos vienen Atila, Gengis Khan, Almanzor, Hitler, Stalin... El Gran Guardabosque se va acercando al país dulce, de clima bondadoso, de refinada cultura clásica, de límpidas y gratas costumbres, La Marina. Cuanto se ve desde La Marina parece una síntesis geográfica e histórica. Como en los sueños, desde los Acantilados de Mármol se divisa una condensación de tiempos y paisajes. Se perciben valores y hábitos de tiempos medievales, la persistencia de códigos caballerescos, monacales, campesinos, etc. de aquellos siglos lejanos, en unión onírica con elementos propios de la contemporaneidad (automóviles, por ejemplo). La Marina recuerda la Europa mediterránea y templada, el entorno de países con fuerte cultura clásica, países de ricos viñedos y tradiciones hermosas. Por el contrario, el Gran Guardabosque representa la zafiedad de quien procede de brumosos y oscuros bosques, prototipo del bárbaro, al que unos climas y territorios poco amables no pueden afectarle de otro modo sino por embrutecimiento. Sin embargo, la figura del Gran Guardabosque es muy compleja en esta obra de Jünger. No es el "bruto", no carece de cierta grandeza, pese a que su acción sobre la Civilización será nefasta. Los personajes que de todo punto repugnan son los que les siguen, aquellos a quienes sus tropas reclutan y movilizan. La canalla, la hez, aquellos que conforman –en toda civilización o comunidad gastada- la Oclocracia. Tras Aristóteles, las descripciones spenglerianas de la Oclocracia nos parecen aquí fundamentales.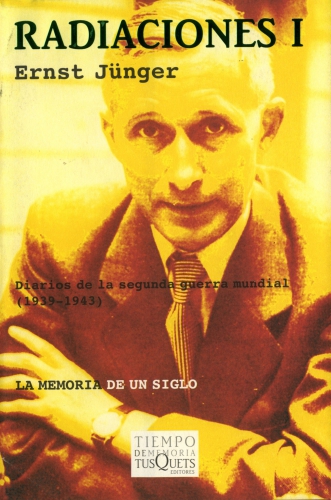 Pero nuestro libro muestra precisamente que las “condiciones ordinarias” ya no se darán más. El mundo que rodeaba La Marina no desconocía las guerras, la muerte, los códigos de honor, de heroismo y sangre. De hecho, en la Marina todo se experimenta: la paz, el amor, la ciencia y la guerra. Todo se vive de forma absoluta como si se presentara en oníricas condensaciones. Así vivimos en los sueños, mezclando pasado, presente y futuro, reuniendo a vivos y muertos. Edad antigua, edad media, renacimiento y el más puro siglo XX, todo coexiste en la novela.
Pero nuestro libro muestra precisamente que las “condiciones ordinarias” ya no se darán más. El mundo que rodeaba La Marina no desconocía las guerras, la muerte, los códigos de honor, de heroismo y sangre. De hecho, en la Marina todo se experimenta: la paz, el amor, la ciencia y la guerra. Todo se vive de forma absoluta como si se presentara en oníricas condensaciones. Así vivimos en los sueños, mezclando pasado, presente y futuro, reuniendo a vivos y muertos. Edad antigua, edad media, renacimiento y el más puro siglo XX, todo coexiste en la novela. 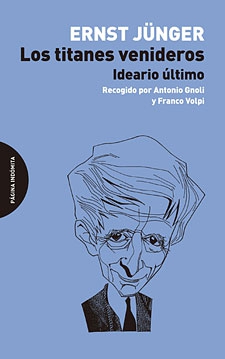 Las personas más civilizadas pueden tener por seguro que en su propio hogar, en su misma caverna, compartiendo la olla y el lecho, hay también una naturaleza salvaje, una semilla de la ancestral barbarie. Más aún, en esas selvas de cemento y hormigón, que se llaman ciudades, anidan las condiciones perfectas de un retroceso, como supieron ver otras grandes mentes de la generación de Jünger; así es el caso de Oswald Spengler. Justamente cuando envejece una civilización y el alma de los hombres se reseca, en la misma fase en que los grandes valores que la vivifican quedan angostados, entonces sucede que el fondo más primitivo y salvaje pase a un primer plano. Ese fondo es el de Lampusa, la caverna y la cocinera del héroe y del sabio. El salvajismo del hombre de la era técnica y de la gran urbe, nos tememos, es de una peor especie que del “primitivo natural”. No proviene de una ingenuidad y de una múltiple vía para recorrer posibilidades y actualizarlas, sino precisamente procede de la muerte y desecación de importantes regiones del alma humana, proviene de una degeneración. La cabaña de Köppelsbleek, con sus calaveras y manos clavadas absurdamente, y los instrumentos para desollar cuerpos humanos a la vista, representa el retroceso demasiado fácil en que la Civilización puede incurrir. Las hogueras en los bosques, las cabañas, granjas, graneros, en fin, la destrucción de los esfuerzos humanos por civilizar el mundo, por cultivar, son prueba irrefutable de cuán fácilmente la destrucción se adueña de todo, y el caos siempre está del lado de los elementos más retardatarios de la Civilización.
Las personas más civilizadas pueden tener por seguro que en su propio hogar, en su misma caverna, compartiendo la olla y el lecho, hay también una naturaleza salvaje, una semilla de la ancestral barbarie. Más aún, en esas selvas de cemento y hormigón, que se llaman ciudades, anidan las condiciones perfectas de un retroceso, como supieron ver otras grandes mentes de la generación de Jünger; así es el caso de Oswald Spengler. Justamente cuando envejece una civilización y el alma de los hombres se reseca, en la misma fase en que los grandes valores que la vivifican quedan angostados, entonces sucede que el fondo más primitivo y salvaje pase a un primer plano. Ese fondo es el de Lampusa, la caverna y la cocinera del héroe y del sabio. El salvajismo del hombre de la era técnica y de la gran urbe, nos tememos, es de una peor especie que del “primitivo natural”. No proviene de una ingenuidad y de una múltiple vía para recorrer posibilidades y actualizarlas, sino precisamente procede de la muerte y desecación de importantes regiones del alma humana, proviene de una degeneración. La cabaña de Köppelsbleek, con sus calaveras y manos clavadas absurdamente, y los instrumentos para desollar cuerpos humanos a la vista, representa el retroceso demasiado fácil en que la Civilización puede incurrir. Las hogueras en los bosques, las cabañas, granjas, graneros, en fin, la destrucción de los esfuerzos humanos por civilizar el mundo, por cultivar, son prueba irrefutable de cuán fácilmente la destrucción se adueña de todo, y el caos siempre está del lado de los elementos más retardatarios de la Civilización.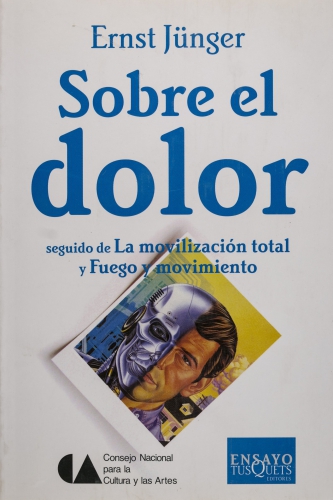
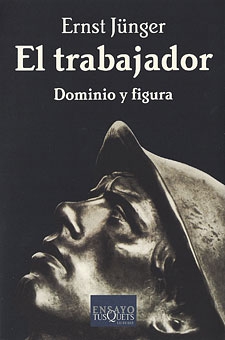 El veterano “mauritano” y el príncipe, en su visita a la Ermita representan esa necesidad de conservar el honor, la identidad, la tradición. El príncipe, un joven viejo, lleva en su sangre azul el instinto de repeler al Caos, de plantar batalla a ese Poder entrópico. Ser digno de nuestros mayores, ponerse a la altura de las glorias pasadas... Esto puede ayudar, pero nunca será lo bastante para la nueva situación de emergencia. El príncipe representa un pasado, una aristocracia que se despide y cuya sangre está diluída, ejerciendo un papel en la historia que acabará en irrelevancia. Todavía puede concitar focos de resistencia, pues esa sangre es sabedora de las viejas luchas. El instinto dirá, en nuestro caso hispano, cuándo hay que resucitar el ardor de Covadonga o de Las Navas de Tolosa, el empuje de la Reconquista o de los Tercios, pero no nos será dable recuperar un pasado, aun cuando fuese éste de lo más glorioso. Pues los desafíos nuevos exigen algo más, mucho más que retomar modelos del pasado. El Enemigo de nuestra Civilización no es fácilmente visible tras de una frontera (“hay moros en la costa”) o una bandera. El Enemigo, en tanto que alteridad irreductible y conjunto de valores inasimilables en nuestra Civilización, ha tomado posiciones de índole estructural. La estrategia del caos de éste Gran Guardabosque ha consistido en contar con algo más que “invasiones” físicas y amenazas armadas. Es una estrategia de confusionismo ideológico. Todos los pilares axiológicos de Europa van siendo dinamitados uno a uno, ante una indiferencia general o un aplauso orquestado desde las “ideologías”. Hoy en día, liberales o marxistas, socialdemócratas o conservadores, hoy en día todos aplauden orquestadamente en medio de un silencio de corderos. Los ideólogos difunden ideologías y supersticiones, llámense “democracia” o “derechos humanos”, por encima de las pequeñas diferencias de detalle en cuanto a programas de gobierno o reformas económico-políticas, matices en el estilo o verborrea doctrinaria. El príncipe ya no puede mover a una clase caballeresca que enarbole la bandera de la buena “tradición”. Apenas un puñado frente al griterío de masas barbarizadas. Los programas aristocráticos de un Spengler o de un Jünger, su “socialismo” nacionalista, su conservadurismo no reaccionario nada tenían que ver con la movilización parda o roja de masas intoxicadas. La verdadera sangre azul que pudiera hacer frente a la muchedumbre parda y roja, eran cuatro gotas ya impotentes en la República de Weimar. Y otro tanto se diga del arquetipo del veterano militar “mauritano”. Los “mauritanos”, orden militar, podrán nutrir siempre a ese conjunto de fuerzas que son el brazo del nacionalista, de quien desea proteger a su patria de los enemigos externos o internos. Pero estos hombres duros, curtidos, gente de armas que llevan siempre afiladas para la ocasión bien pueden errar y pasarse a las filas del Caos, contribuir al Caos mismo. También se observa que aquellos que se presentan como protectores, y que han sido designados para tal función, se agazapan esperando el cambio de poder y su adaptación a los nuevos tiempos. Tal es el destino de las manzanas podridas: se convierten en el cobijo de toda clase de gusanos.
El veterano “mauritano” y el príncipe, en su visita a la Ermita representan esa necesidad de conservar el honor, la identidad, la tradición. El príncipe, un joven viejo, lleva en su sangre azul el instinto de repeler al Caos, de plantar batalla a ese Poder entrópico. Ser digno de nuestros mayores, ponerse a la altura de las glorias pasadas... Esto puede ayudar, pero nunca será lo bastante para la nueva situación de emergencia. El príncipe representa un pasado, una aristocracia que se despide y cuya sangre está diluída, ejerciendo un papel en la historia que acabará en irrelevancia. Todavía puede concitar focos de resistencia, pues esa sangre es sabedora de las viejas luchas. El instinto dirá, en nuestro caso hispano, cuándo hay que resucitar el ardor de Covadonga o de Las Navas de Tolosa, el empuje de la Reconquista o de los Tercios, pero no nos será dable recuperar un pasado, aun cuando fuese éste de lo más glorioso. Pues los desafíos nuevos exigen algo más, mucho más que retomar modelos del pasado. El Enemigo de nuestra Civilización no es fácilmente visible tras de una frontera (“hay moros en la costa”) o una bandera. El Enemigo, en tanto que alteridad irreductible y conjunto de valores inasimilables en nuestra Civilización, ha tomado posiciones de índole estructural. La estrategia del caos de éste Gran Guardabosque ha consistido en contar con algo más que “invasiones” físicas y amenazas armadas. Es una estrategia de confusionismo ideológico. Todos los pilares axiológicos de Europa van siendo dinamitados uno a uno, ante una indiferencia general o un aplauso orquestado desde las “ideologías”. Hoy en día, liberales o marxistas, socialdemócratas o conservadores, hoy en día todos aplauden orquestadamente en medio de un silencio de corderos. Los ideólogos difunden ideologías y supersticiones, llámense “democracia” o “derechos humanos”, por encima de las pequeñas diferencias de detalle en cuanto a programas de gobierno o reformas económico-políticas, matices en el estilo o verborrea doctrinaria. El príncipe ya no puede mover a una clase caballeresca que enarbole la bandera de la buena “tradición”. Apenas un puñado frente al griterío de masas barbarizadas. Los programas aristocráticos de un Spengler o de un Jünger, su “socialismo” nacionalista, su conservadurismo no reaccionario nada tenían que ver con la movilización parda o roja de masas intoxicadas. La verdadera sangre azul que pudiera hacer frente a la muchedumbre parda y roja, eran cuatro gotas ya impotentes en la República de Weimar. Y otro tanto se diga del arquetipo del veterano militar “mauritano”. Los “mauritanos”, orden militar, podrán nutrir siempre a ese conjunto de fuerzas que son el brazo del nacionalista, de quien desea proteger a su patria de los enemigos externos o internos. Pero estos hombres duros, curtidos, gente de armas que llevan siempre afiladas para la ocasión bien pueden errar y pasarse a las filas del Caos, contribuir al Caos mismo. También se observa que aquellos que se presentan como protectores, y que han sido designados para tal función, se agazapan esperando el cambio de poder y su adaptación a los nuevos tiempos. Tal es el destino de las manzanas podridas: se convierten en el cobijo de toda clase de gusanos.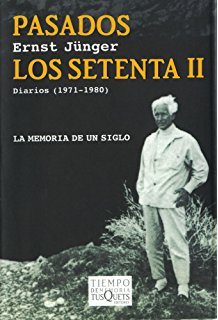 No se trata de una ciencia entendida como “fuerza productiva”. No se trata de esa tecnología que hoy impera, completamente desconectada de la admiración. La verdadera ciencia y la filosofía se identificaban en los clásicos griegos y en los escolásticos medievales. La curiosidad innata e insaciable del hombre entonces no debía quedar presa de afanes mezquinos, afanes de “tendero”. La curiosidad del sabio, al igual que el honor del guerrero, no “sirven para nada” salvo para justificar la Civilización misma. Nada menos. Las cosas más nobles –arte, ciencia, filosofía, - no sirven para nada porque su función consiste en dar fundamento a la existencia. Y una existencia dotada de fundamento es una existencia verdaderamente humana, civilizada, feliz.
No se trata de una ciencia entendida como “fuerza productiva”. No se trata de esa tecnología que hoy impera, completamente desconectada de la admiración. La verdadera ciencia y la filosofía se identificaban en los clásicos griegos y en los escolásticos medievales. La curiosidad innata e insaciable del hombre entonces no debía quedar presa de afanes mezquinos, afanes de “tendero”. La curiosidad del sabio, al igual que el honor del guerrero, no “sirven para nada” salvo para justificar la Civilización misma. Nada menos. Las cosas más nobles –arte, ciencia, filosofía, - no sirven para nada porque su función consiste en dar fundamento a la existencia. Y una existencia dotada de fundamento es una existencia verdaderamente humana, civilizada, feliz.