Youssef Hindi est historien des religions et géopolitologue. Spécialiste du messianisme et de ses implications historiques, politiques et géopolitiques, ses recherches inédites ont levé le voile sur les origines d’idéologies modernes, parmi lesquelles le sionisme, le socialisme et le républicanisme français. Il est l’auteur de nombreux articles de prospective sur les relations internationales et de six ouvrages dont La Mystique de la Laïcité : Généalogie de la religion républicaine (éd. Sigest), Du Brexit aux Gilets jaunes (éd. Sigest), et Occident & Occident – Tome I : Sources et genèse messianiques du sionisme (éd. Sigest). Il est aussi co-auteur de l’étude “Notre-Dame, Al Aqsa et le troisième Temple. La géopolitique des religions” réalisée pour Strategika.

Strategika – On lit beaucoup d’éléments contradictoires selon les différentes sources d’information disponibles ou selon les avis des professionnels de la santé. Quelle est la réalité effective de cette pandémie selon vous ?
N’étant pas moi-même un professionnel de la santé, je me limiterai, pour ce qui est de la réalité de l’épidémie, à reprendre différentes études statistiques officielles, tout particulièrement sur la létalité réelle du Covid-19.
Des chiffres et des faits
Depuis le début de l’épidémie au jour où j’écris ces lignes (6 avril 2020), il y a eu 1 276 302 personnes infectées dans le monde. Sur ce total, 264 048 personnes sont guéries et 69 527 sont mortes[i]. Rapporté à la population mondiale, 7,794 milliards d’individus, c’est infime.
C’est un chiffre qui est également faible comparé au nombre de morts causés par la grippe saisonnière : entre 290 000 et 650 000 décès par an, d’après l’OMS (Organisation mondiale de la Santé)[ii].
La létalité de la grippe saisonnière se situe entre 0,2% et 0,5%. La létalité du Covid-19 serait, quant à elle, de 2,3% à 2,6%, d’après une étude publiée par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC), qui analyse les données collectées jusqu’au 11 février 2020.
Toutefois, ces deux maladies, Covid-19 et ce qu’on appelle la grippe saisonnière, ne touchent pas les mêmes personnes. La grippe saisonnière touche beaucoup les enfants, mais avec un très faible taux de mortalités, tandis que les personnes âgées, moins atteintes, ont le taux de mortalité le plus élevé, explique Bruno Lina, virologue et chercheur au Centre international de recherche en infectiologie (Ciri). Ainsi, 64% des morts de la grippe saisonnière en 2018-2019 avaient plus de 65 ans, selon Santé publique France.
Le Covid-19, explique le CDC chinois, ne touche pas les enfants. Les moins de 10 ans représentent moins de 1% des personnes contaminées. En revanche, expliquait le virologue (fin février) français susmentionné, « on observe des formes graves de Covid-19 chez des adultes de moins de 65 ans, ce qui est rare pour la grippe. Ce n’est pas la même épidémie, elle n’a pas la même circulation et ne touche pas les mêmes tranches d’âge. »

Et depuis cette interview de Bruno Lina, nous avons un peu plus de recul et de données.
Prenons le pays le plus mortellement frappé par le Covid-19, l’Italie. L’Institut supérieur de santé publique (ISS) italien a publié un rapport officiel le 17 mars[iii] mettant en évidence que l’âge moyen des personnes mortes (sur 2003 cas mortels) du Covid-19 est de 80 ans et demi. Sur les 17 personnes de moins de 50 ans qui sont décédés, 5 avaient de graves pathologies précédentes. Recensant une dizaine de pathologie les plus courantes relevées sur les personnes décédées, dont les plus fréquentes sont l’hypertension, le diabète ou la cardiopathie ischémique, l’ISS souligne que 48,5% des personnes décédées souffraient de trois ou plus de ces pathologies et 25,6% de deux pathologies. Seulement 0,8% des personnes, trois au total, n’avaient aucune pathologie, toujours d’après l’ISS.
En France, au 31 mars, 3 523 personnes sont décédées à l’hôpital, et parmi elles 84% étaient âgées de 70 ans et plus.[iv]
En Chine, l’étude réalisée par le CDC sur un échantillon de 72 314 personnes, montre que plus de 80% des morts du Covid-19 sont des personnes âgées : 60-69 ans : 30,2% ; 70-79 ans : 30,5% ; 80 ans et + : 20,3% des victimes.[v]
En conclusion, la létalité du Covid-19 est globalement très faible et il n’est dangereux que pour les personnes en fin de vie et/ou ayant de graves pathologies.
L’épidémie est bien réelle, mais sa gravité est à relativiser. La dangerosité du Covid-19 est très largement exagérée par les pouvoirs publics et les médias qui ont provoqué une panique mondiale. C’est d’ailleurs l’avis de dizaines d’épidémiologistes et virologues de renommée internationale, à l’instar du Docteur Karin Mölling – une virologue allemande dont les travaux ont porté sur les rétrovirus – qui explique :
« On vous dit maintenant chaque matin combien il y a de décès dus au SRAS-Corona 2 (Covid-19). Mais on ne vous dit pas combien de personnes sont déjà infectées par la grippe cet hiver et combien de décès elle a causés.
Chaque semaine, une personne meurt à Berlin de germe. Cela représente 35 000 décès par an en Allemagne. On n’en parle pas du tout. Je pense que nous avons connu des situations comme celle-ci à plusieurs reprises et que les mesures prises sont maintenant exagérées. »[vi]
Ce n’est pas la première fois qu’on grossit à l’échelle planétaire la gravité d’un virus. Souvenez-vous du H1N1 que l’on nous a présenté en 2009 comme une pandémie dangereuse pour l’Humanité. En France, un scandale avait éclaté à cette occasion. La psychose provoquée autour du H1N1 a conduit à une campagne de vaccination presque forcée par la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Cette dernière avait fait acheter par l’État français pour plusieurs centaines millions d’euros[vii] de vaccins[viii] produit par le laboratoire pharmaceutique Astra Zaneca[ix] (anciennement ICI Pharma) dont elle avait été salariée, au poste de déléguée à l’information médicale, de 1969 à 1976[x].
L’annonce, le 4 janvier 2010, de la revente à l’étranger d’un certain nombre de doses de vaccins avait mis le feu aux poudres ; les partis politiques, du Parti communiste au Nouveau centre, en passant par le PS, le Modem et le Nouveau Parti anticapitaliste, avaient pilonné la campagne de vaccination antigrippe du gouvernement : « Fiasco », « scandaleux échec », « faute stratégique lourde »… Le 4 janvier 2010, le porte-parole du Parti socialiste, Benoît Hamon, demanda une « commission d’enquête » parlementaire sur le sujet, et qui a effectivement été ouverte en 2010 sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination de la grippe A (H1N1). De nombreux responsables ont été auditionnés, dont Madame Bachelot (le 15 juin 2010)[xi]. Loin d’avoir été condamnée, Roselyne Bachelot est aujourd’hui omniprésente sur les plateaux de télévision (notamment LCI) pour donner son avis et ses conseils dans le contexte de la crise du coronavirus.
À la fin de l’épidémie H1N1, en 2010, le virologue Bruno Lina reconnut qu’« on en a fait beaucoup plus que ce qui était nécessaire » contre la grippe A (H1N1), et d’ajouter que « le virus n’était pas aussi dangereux qu’on l’avait cru… »[xii]
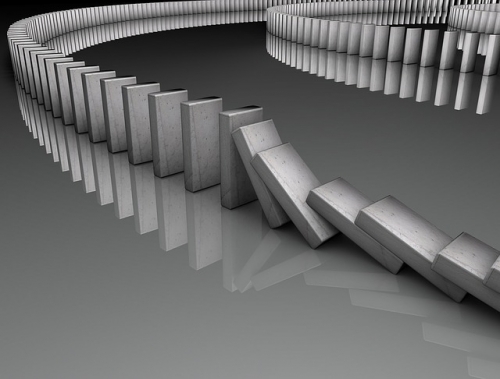
Strategika – Cette pandémie précède-t-elle un effondrement économique et systémique selon vous ?
En préambule de ma réponse, je citerai quelques scientifiques, à commencer par le Docteur David Katz, le directeur fondateur du Centre de recherche sur la prévention de l’université de Yale (Yale-Griffin Prevention Research Center), qui explique que ce n’est pas la pandémie qui causera le plus de morts, mais bien la politique de confinement totale :
« Je suis profondément préoccupé par le fait que les conséquences sociales, économiques et de santé publique de cet effondrement quasi-total de la vie normale – écoles et entreprises fermées, rassemblements interdits – seront durables et désastreuses, peut-être plus graves que le bilan direct du virus lui-même. Le marché boursier se redressera à temps mais de nombreuses entreprises ne le feront jamais. Le chômage, l’appauvrissement et le désespoir qui en résulteront probablement seront des fléaux de santé publique de premier ordre. » (« Notre lutte contre le coronavirus est-elle pire que la maladie ? », New York Times, 20 mars 2020)[xiii]
 D’après Frank Ulrich Mongtomery, radiologue allemand, ancien président de l’Association médicale allemande et vice-président de l’Association médicale mondiale, le confinement total est non seulement inefficace, mais aussi contre-productif :
D’après Frank Ulrich Mongtomery, radiologue allemand, ancien président de l’Association médicale allemande et vice-président de l’Association médicale mondiale, le confinement total est non seulement inefficace, mais aussi contre-productif :
« Je ne suis pas un fan du confinement. Quiconque impose une telle mesure doit aussi dire quand et comment en sortir. Puisque nous devons supposer que le virus sera présent pendant longtemps, je me demande quand reviendrons-nous à la normale ? On ne peut pas garder les écoles et les garderies fermées jusqu’à la fin de l’année. Parce que cela prendra au moins autant de temps avant que nous ayons un vaccin. L’Italie a imposé un verrouillage et a obtenu l’effet inverse. Ils ont rapidement atteint leurs limites de capacité, mais n’ont pas ralenti la propagation du virus pendant le confinement.» (Interview pour le General Anzeiger, 18 mars 2020)
C’est également l’avis du professeur Didier Raoult, le directeur de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille ayant obtenu des résultats positifs en administrant de la chloroquine aux malades du coronavirus[xiv], qui déclarait lors d’une interview donnée le 17 mars 2020 :
« Il n’y a pas de catastrophe qui justifie des mesures dignes d’une catastrophe atomique… Il faut arrêter de raconter des choses qui terrifient les gens. Evidemment, si vous ne testez que les gens en réanimation, et vous dites à tous les gens qui sont malades de rester chez eux, vous aurez une vision de la maladie qui n’aura rien à voir avec la gravité (réelle) de la maladie…
Moi je ne vois pas de signaux de la maladie qui soit spécifiquement redoutable ; je ne vois pas de modification de la mortalité générale dans le pays. Je continue à penser qu’il faut raison garder.
Il faut faire comme pour les maladies infectieuses en général : du diagnostic.
Le confinement en Italie n’empêche pas une évolution exponentielle (du nombre de malades) ; il continue à y avoir une évolution exponentielle en France et en Espagne. Et ces trois pays ont décidé de mettre au premier plan le confinement. On peut se poser la question s’il ne faut pas réfléchir, accepter de changer d’opinion, ce qui est une forme d’intelligence sous la pression des événements, et repartir sur ce qu’a fait la Corée (du Sud), c’est-à-dire multiplier les tests, traiter les gens, et n’isoler que les gens positifs. On ne peut pas isoler toute la population !
Ce n’est plus de la science, c’est de la science-fiction ou de la sorcellerie ! »[xv]
Par conséquent, l’on peut légitimement se demander si le confinement total n’a pas pour objectif de détruire l’économie. Car ce qu’on appelle « effondrement économique » est au fond la destruction de l’économie réelle par l’économie fictive, la finance spéculative, dont les tenants contrôlent la politique économique de nombre de pays occidentaux.
Cet « effondrement » est une étape dans le processus de domination des sociétés par le système bancaire. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, sinon l’évolution technique, mais le principe reste le même. Depuis sa naissance dans la Haute Antiquité, la pratique du prêt à intérêt a pour conséquence ultime et objectif non avoué la réduction à l’esclavage, plus précisément au péonage, du paysan, de sa famille, et par suite du peuple laborieux[xvi].
Cette pandémie, ou plutôt les politiques de confinement mises en œuvre en Occident pour y « répondre » – à quelques exceptions près – précèdent surtout une spoliation massive des peuples qui aura pour conséquence leur réduction en esclavage s’il n’y a aucun sursaut de leur part.
Le confinement total est un moyen d’achever le processus d’appauvrissement des classes moyennes et des ouvriers occidentaux que le libre-échangisme mondialisé a bien entamé. Le libre-échange a détruit une partie de l’industrie occidentale – qui a été délocalisée en Asie – et fait pression sur les salaires ; ce système a provoqué un surendettement des particuliers et des États, notamment aux USA[xvii]. Et les étapes de ce processus sont bien connues : la déréglementation bancaire et financière en 1980 avec le Depository Institutions Deregulation and Monetary Control act qui fut suivi en 1999 par le Gramm-Leach-Bliley Act abolissant le Glass-Steagall Act (établi en 1933) qui séparait les banques de dépôt et les banques d’investissement.
C’est cette dérégulation, permettant aux banques de jouer avec les économies des épargnants, qui a conduit à la crise de 2008. À la suite de quoi les États ont renfloué ces mêmes banques avec l’argent du contribuable : privatisation des gains et socialisation des pertes.
Nombre d’économistes annonçaient pour 2020 une nouvelle crise financière d’ampleur plus importante que celle de 2008[xviii].

L’on peut légitimement se demander également si cette pandémie n’est pas une opportunité, pour les tenants de la finance internationale et leurs auxiliaires, d’opérer cette grande spoliation, sans être désignés comme coupables. Le responsable désigné serait alors cet « ennemi invisible » contre qui nous serions « en guerre ». Or, ce n’est pas la pandémie qui met à l’arrêt l’économie réelle, mais la panique artificiellement provoquée et les mesures étatiques excessives.
Le coronavirus a fait chuter en mars la Bourse new-yorkaise de 20% par rapport à son record de février[xix] ; et en France, le CAC 40 a perdu en un mois plus de 37% par rapport à son plus haut atteint le 19 février.
Je rappelle encore que l’objectif des banquiers internationaux est l’appauvrissement des masses, pas leur prospérité. Raison pour laquelle Christine Lagarde, l’ancienne directrice du Fond monétaire international (FMI) – qui est un instrument des banquiers – a déclaré en 2012, alors qu’elle était en poste :
« Quand le monde qui tourne autour du FMI va mal, nous, nous nous portons bien. C’est dans ces périodes que nous commençons à devenir particulièrement actifs, car nous prêtons de l’argent et nous gagnons sur les intérêts, et toutes les charges, et c’est là que notre institution prospère, qu’elle se porte bien. »[xx]
Pour que cela paraisse plus clair au lecteur, je vais résumer en quelques lignes le fonctionnement et le rôle du FMI.
Les recettes administrées par le FMI aux pays d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’une partie de l’Asie, mais aussi à la Grèce et aux pays développés en période de crise, se résument ainsi :
- Austérité budgétaire
- Contraction du crédit
- Dérèglementation
- Privatisation
- Libre-échange de marchandises et de capitaux[xxi]
Chaque fois que des pays en voie de développement se trouve en déficit budgétaire – à cause de la politique préconisée par l’OMC (Organisation mondial du commerce) et le FMI –, intervient l’institution internationale en faisant entrer des capitaux étrangers pour combler le déficit ; rôle que la banque centrale de chaque pays peut remplir mais qu’interdit le FMI.
Cela entraine une réévaluation de la monnaie à la hausse, augmentant ainsi le déficit commercial. En résulte la fuite potentielle des capitaux étrangers[xxii].
En somme, le rôle du FMI consiste à mettre à genou les pays ciblés et à les réduire en péonage pour le compte des banquiers internationaux.
Et pour régner définitivement sur le monde, le banquier doit également faire main basse sur l’épargne des classes moyennes supérieures. Et c’est ce qu’on a pu observer quelques mois avant le déclenchement de l’épidémie.
Dans les quatre mois de 2019 qui ont précédé le coronavirus, les banquiers et assureurs ont incité les Français à privilégier les supports investis en Bourse, dans le cadre de l’assurance-vie. Ces supports boursiers ont représenté près de 35% de la collecte, d’après les chiffres de la Fédération française de l’assurance. Un niveau d’investissement boursier des particuliers Français qui a nettement progressé, alors que le coronakrach approchait. Le PDG de la société de gestion Cholet Dupont a déclaré que :
« C’est la première fois qu’une crise sanitaire est à l’origine d’une crise financière. On va dans l’inconnu. »[xxiii]
Les fonds détenus par les particuliers, en actions, ont enregistré des pertes de 20 à 40% depuis le début de l’année. La chute des marchés va affecter une partie de l’épargne des Français via l’assurance-vie qui est leur placement le plus important : 1 789 milliards d’euros d’encours.
Dans un communiqué publié le 10 mars 2020, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution observait :
« Les clients sont de plus en plus souvent incités à orienter tout ou partie de leur épargne en assurance–vie vers des supports en unités de compte plutôt que vers des supports en euros. »
Y-a-t-il eu derrière cette incitation un délit d’initiés ?
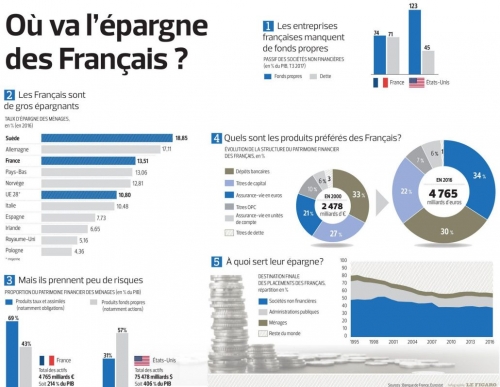
Quoi qu’il en soit, les banquiers lorgnent sur l’épargne que les Français ont placées sur les comptes courants ou conservées en liquide à hauteur de 603,8 milliards d’euros, fin septembre 2019, quasi deux fois plus qu’il y a dix ans, selon les derniers chiffres de la Banque de France[xxiv].
Ce n’est pas une supposition de ma part, c’est un projet qui est dans les cartons des banquiers depuis plusieurs années. En 2013, le FMI a établi un rapport sur les finances publiques qui posait, encore une fois, le problème de la soutenabilité des dettes des États « avancés » : l’Europe, les Etats-Unis, le Japon. Et pour régler ce « problème », le FMI a proposé un prélèvement « une fois pour toute » sur l’épargne privée pour réduire la dette publique. Les économistes du FMI ont fait un calcul pour quinze pays de la zone euro dans leur rapport :
« Les taux de taxation nécessaires pour ramener les ratios de dettes (par rapport au PIB) à leur niveau de la fin 2007 nécessiteraient une imposition d’environ 10% sur tous les ménages disposant d’une épargne nette positive. »[xxv]
En résumé, le FMI préconise une politique économique conduisant à la contraction de crédit par les États, et en dernière instance il va, pour le compte du système bancaire, organiser un racket généralisé des épargnants privées pour rembourser une dette illégitime.
Et il y a eu des précédents. Confrontée à une grave crise financière en 1992, l’Italie voyait sa dette publique frôler les 120%. Le gouvernement a choisi une solution radicale pour rentrer in extremis dans les critères de Maastricht. Le socialiste Giuliana Amato a fixé le taux de taxation à 0,6% sur l’ensemble des dépôts italiens positifs. Ainsi, 15 milliards d’euros ont été ponctionnés.
« Il y a eu un travail d’explication en amont. La mesure n’était pas considérée comme confiscatoire, mais comme un effort collectif nécessaire pour assainir les finances du pays » analysait le cabinet Weave dans Le Monde en mars 2013[xxvi]. Pourtant, « le traumatisme a été tel qu’aucun politicien ne s’y est risqué une seconde fois », expliquait Galileo Global Advisors à la même époque dans Challenges[xxvii].
 Le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, interrogé à l’époque sur l’éventuelle taxation de l’épargne des Français, avait répondu « en théorie c’est possible, mais notre rôle est de faire en sorte que cela n’arrive jamais »[xxviii]
Le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, interrogé à l’époque sur l’éventuelle taxation de l’épargne des Français, avait répondu « en théorie c’est possible, mais notre rôle est de faire en sorte que cela n’arrive jamais »[xxviii]
Au printemps 2013, Chypre a ponctionné 47,5% sur les dépôts de plus de 100 000 euros afin de se voir accorder un plan d’aide international. C’était, comme nombre d’analystes l’ont compris, un ballon d’essai, avant de taxer à plus grande échelle. Aujourd’hui le coronavirus est le prétexte idéal.
C’est ce qu’appelait Karl Marx le rançonnage des États. Un système de spoliation qu’il avait bien décrit :
« L’endettement de l’État était d’un intérêt direct pour la fraction de la bourgeoisie qui gouvernait et légiférait au moyen des Chambres. C’était précisément le déficit de l’État, qui était l’objet même de ses spéculations et le poste principal de son enrichissement. À la fin de chaque année, nouveau déficit. Au bout de quatre ou cinq ans, nouvel emprunt. Or, chaque nouvel emprunt fournissait à l’aristocratie une nouvelle occasion de rançonner l’État, qui, maintenu artificiellement au bord de la banqueroute, était obligé de traiter avec les banquiers dans les conditions les plus défavorables. Chaque nouvel emprunt était une nouvelle occasion de dévaliser le public qui place ses capitaux en reste sur l’Etat, au moyen d’opérations de Bourse, au secret desquelles gouvernement et majorité de la Chambre étaient initiés.
En général, l’instabilité du crédit public et la connaissance des secrets d’État permettaient aux banquiers, ainsi qu’à leurs affiliés dans les Chambres et sur le trône, de provoquer dans le cours des valeurs publiques des fluctuations insolites et brusques dont le résultat constant ne pouvait être que la ruine d’une masse de petits capitalistes et l’enrichissement fabuleusement rapide des grands spéculateurs.
Pendant que l’aristocratie financière dictait les lois, dirigeait la gestion de l’État, disposait de tous les pouvoirs publics constitués, dominait l’opinion publique par la force des faits et par la presse, dans toutes les sphères, depuis la cour jusqu’au café borgne se reproduisait la même prostitution, la même tromperie éhontée, la même soif de s’enrichir, non point par la production, mais par l’escamotage de la richesse d’autrui déjà existante… »[xxix]
Selon toute vraisemblance, le coronavirus sera le moyen, pour « l’aristocratie financière », de spolier la bourgeoisie. Cette bourgeoisie qui s’imagine appartenir à la classe qui organise son appauvrissement.
Quant aux classes sociales les plus basses, le projet, comme je l’ai dit précédemment, c’est leur réduction en esclavage. La destruction des PME et de l’emploi, compensé par un revenu universel minimum pour noyer la population et lui maintenir juste le nez en dehors de l’eau afin de prévenir sa révolte.
Et le coronavirus est le prétexte tout trouvé pour imposer ce « revenu universel » aux États-Unis et en Europe. Ce revenu minimum et universel était d’ailleurs une des propositions du candidat socialiste, Benoît Hamon, à l’élection présidentielle de 2017 en France[xxx].
Au Royaume-Uni, 170 parlementaires de différents partis ont adressé le 19 mars dernier une lettre au gouvernement britannique, lui demandant de mettre en place un « revenu universel d’urgence » le temps de la pandémie[xxxi].
Le gouvernement espagnol a annoncé, par la voix de sa ministre de l’Économie Nadia Calvino, la mise en place dès que possible d’un « revenu vital minimum » pour combattre les répercussions économiques causées par la pandémie. Mais cette mesure pourrait être adoptée « de manière générale et permanente »[xxxii].
En Allemagne, le ministre social-démocrate des Finances, Ola Scholz (SPD), envisage de dégager des fonds « illimités » (jusqu’à 150 milliards d’euros), pour « amortir » les répercussions économiques « causés » par la pandémie. Le journal de Francfort, le Frankfurter Rundschau, plaidait le 20 mars, non pour un crédit, mais pour l’instauration d’un revenu de base, d’un montant de 1 000 euros par mois sur une période de six mois. La crise est aussi le temps des possibles, souligne le Frankfurter Rundschau : « L’État devrait se saisir de l’opportunité pour introduire le revenu universel à l’échelle de tout le pays. » [xxxiii]
En France, la proposition de revenu universel s’est retrouvée en bonne place sur la plateforme « Le jour d’après »[xxxiv], lancée le 4 avril 2020 par une soixantaine de députés – notamment LREM[xxxv] – où les Français sont invités à présenter leur vision du monde d’après la crise pour un monde plus « durable ».
Dans le même temps et en toute logique, le gouvernement français a profité de l’état d’urgence sanitaire qu’il a instauré pour « assouplir » (détruire) le code du travail[xxxvi].

Or, il existe une solution simple et efficace, qui est pratiquée depuis l’Antiquité : l’annulation de la dette – suivie d’une reprise de contrôle de la création monétaire et le retour de l’emprunt à la banque centrale, et non plus sur les marchés. Une éventualité que craignent les banquiers. À ce sujet, leur représentante, Christine Lagarde, aujourd’hui présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a répondu, lors d’une interview le 9 avril dernier sur France Inter, à l’idée d’une annulation globale des dettes contractées par les États de la zone euro durant la pandémie du coronavirus : « Ça me paraît totalement impensable… il faudra dans le temps, progressivement, procéder au remboursement des dettes et se remettre dans une pente plus stable et plus propice au bon équilibre des finances publiques… »[xxxvii]
Rappelons à Madame Lagarde que lors de la crise financière de 2008, les banques, fautives, ont été sauvées par les États. Parmi eux, l’État français, Nicolas Sarkozy à sa tête, a renfloué les banques avec l’argent du contribuable, et sans aucune contrepartie[xxxviii].
Strategika – Plus de trois milliards de personnes sont appelées à se confiner dans le monde. Pour la première fois de son histoire, l’Humanité semble réussir à se coordonner de manière unitaire face à un ennemi global commun. Que vous inspire cette situation ?
Il y a dans cette situation, cette atmosphère, quelque chose de fictionnel et d’apocalyptique. Le confinement est une rupture dans la vie des sociétés. Le temps est suspendu car tous les rituels qui régulent et donnent des repères dans la vie des individus et des sociétés sont mis à l’arrêt. Il y a de quoi être déboussolé.
Ceci étant dit, la situation actuelle peut s’expliquer de façon rationnelle :
La mise en quarantaine est pratiquée, en cas d’épidémie, depuis plusieurs siècles[xxxix]. L’ampleur inédite du confinement actuel est la conséquence de la mondialisation. La planétarisation des moyens de transport et la massification sans précédent des voyageurs à l’échelle de l’Histoire ont fait de cette épidémie un problème mondial.
Mais il faut relativiser. Le confinement n’est absolument pas pratiqué de la même façon par tous les pays. Entre la Corée du Sud qui n’a confiné que les malades, pratiqués des tests massifs et soignés les malades, et le gouvernement français qui confine la totalité de la population en conseillant aux malades de rester chez eux jusqu’à ce qu’ils soient au bord de l’agonie, il y a une énorme différence, notamment en termes d’efficacité.
Le gouvernement chinois quant à lui n’a pas confiné le pays dans son entièreté, seulement la région de Hubei (dont Wuhan est la capitale), épicentre de l’épidémie, qui compte environ 60 millions d’habitants.
La Grande-Bretagne a refusé dans un premier temps de confiner sa population, et elle a fini par plier, mais pas seulement sous la pression sociale du village occidental (j’y reviendrai plus bas).
Quant à la Suède, elle se refuse toujours à confiner. Les autorités sanitaires se limitent à des recommandations simples, comme ne pas rendre visites aux grands-parents (les plus fragiles face au virus). Et il n’y a eu au total que 250 morts entre le début de l’épidémie et le 8 avril.

L’économie suédoise continue à fonctionner, les restaurants restent ouverts, de même que les salles de sport. Écoles et collèges continuent d’accueillir les élèves (les universités et les lycées, eux, sont fermés) car « L’absentéisme creuserait et renforcerait à long terme les inégalités sociales », explique la ministre de l’Enseignement secondaire, Anna Ekström[xl].
Et aux États-Unis, il n’y a pas d’uniformité, puisque c’est le gouverneur de chaque État qui est en mesure de prendre la décision de confiner. Au total, une quarantaine d’États (sur cinquante) ont demandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux hormis pour faire des courses ou pour des urgences. Le président Donald Trump a déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité pour le gouvernement fédéral de décider par décret d’un confinement à l’échelle nationale.[xli]
L’idée de confinement totale est venue du très influent épidémiologiste britannique, Neil Ferguson. Il est au cœur du système globaliste : conseiller de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de l’Union européenne, de la Banque mondiale et de plusieurs gouvernements, dont le gouvernement britannique.
J’en profite au passage pour indiquer qu’une enquête menée sur l’OMS en 2016 par les journalistes Jutta Pinzler et Tatjan Mischke pour la chaîne allemande NDR a révélé que l’Organisation mondiale de la Santé est sous le contrôle de Bill Gates, des multinationales pharmaceutiques, et des puissances anglo-américaines[xlii]. Ce reportage a été diffusé le 4 avril 2017 par la chaîne franco-allemande ARTE sous le titre « L’OMS dans les griffes des lobbies »[xliii].
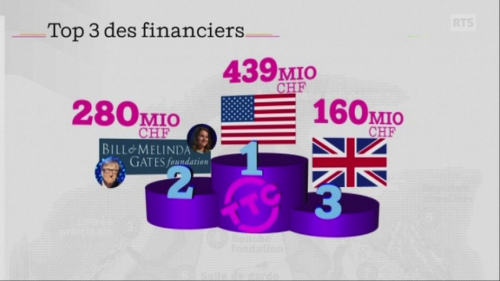
En tant que directeur de l’Imperial College COVID-19 Response Team composée de 50 scientifiques liés à l’OMS, Neil Ferguson a, depuis la mi-janvier, publié 14 rapports très alarmistes, affirmant, par exemple, le 16 mars, que « si rien n’est fait », la Grande-Bretagne compterait jusqu’à 510 000 morts et les États-Unis, 2 200 000 morts.
Le confinement, selon Ferguson, ferait descendre le bilan en Grande-Bretagne à 20 000 morts.[xliv]
D’après le New York Times, c’est ce rapport de Ferguson qui aurait contribué à pousser les États britannique et américain vers une politique de confinement.
Le 30 mars il publie un rapport évaluant la part de la population déjà infectée en Europe ; pour la France, il s’agirait, d’après Ferguson, de 3%, soit 2 millions de personnes[xlv].
À Genève, le très respecté épidémiologiste, Antoine Flahault estime, dans un entretien accordé à l’Obs que les prédictions de Ferguson « sont des spéculations théoriques »[xlvi].
Devi Sridhar, professeure de santé publique à l’université d’Edinburgh, pointe du doigt le fait que ce qui a de l’importance dans ces rapports de l’équipe de Neil Ferguson, n’est pas le contenu, mais ceux qui en sont les auteurs. Ajoutant que Ferguson « a une énorme influence ».
Son influence énorme trouve évidemment son origine chez ses appuis : OMS (qui est une émanation de l’ONU), Banque mondiale…
Raison pour laquelle on fait appel à ses modélisations lors de toutes les épidémies : grippe aviaire, Ebola, Zika, Sras, H1N1…
C’est encore Ferguson qui aurait, par l’intermédiaire du conseil scientifique Covid-19, convaincu Emmanuel Macron d’appliquer le confinement en France. Le Nouvel Observateur rapporte :
« ‘‘Jusqu’à 500 000 morts, si l’on ne fait rien’’ : telle est la prédiction alarmiste de Ferguson qui est présentée le 12 mars à Emmanuel Macron. La fermeture des écoles est annoncée le soir même. Impossible de connaître le détail de ce chiffrage, il n’est pas public, il a fait seulement l’objet d’une ‘‘communication personnelle’’ via le conseil scientifique Covid-19. Au sein de ce cénacle, le modélisateur Simon Cauchemez connaît bien les travaux du savant britannique : les deux hommes ont travaillé ensemble de 2005 à 2013. »[xlvii]
Simon Cauchemez, relai en France de Ferguson – et donc de la propagande des institutions globalistes, de Bill Gates et de l’industrie pharmaceutique – a passé son doctorat en bio-statistiques appliquées à l’épidémiologie des maladies infectieuses en 2005 à l’INSERM, et a rejoint la même année l’université Imperial College London en tant que post-doctorant dans l’équipe de Neil Ferguson, puis comme professeur associé. Il rejoint l’Institut Pasteur à Paris en 2013 pour y devenir le directeur du laboratoire de modélisation mathématique des maladies infectieuses qu’il a fondé[xlviii].
À l’instar de Ferguson, il a été impliqué dans la modélisation de l’épidémie de grippe A (H1N1) de 2009[xlix], de Chikungunya (2013-2014)[l], du Zika (2015-2016) dans les Amériques, et d’Ebola en Afrique…
Et comme l’a souligné l’Obs, Simon Cauchemez est également membre du conseil scientifique COVID-19 mis en place par le ministre français de la santé, afin d’informer le gouvernement au cours de l’épidémie, en tant que modélisateur.
Le confinement total des populations n’est pas une réponses scientifique efficace à l’épidémie, comme l’ont souligné nombre de scientifiques précités.
Nous avons donc affaire ici, de toute évidence, à la mise en place d’un projet politique. Ce qui nous amène à la question suivante.
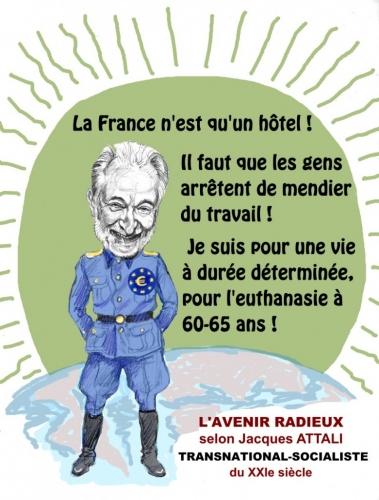
Strategika – Cette pandémie va-t-elle forcer l’humanité à se doter d’un gouvernement mondial comme le préconisait Jacques Attali lors de la pandémie de grippe A en 2009 ? En 2009 toujours, Jacques Attali expliquait que “l’Histoire nous apprend que l’humanité n’évolue significativement que lorsqu’elle a vraiment peur”. Que vous inspire cette idée ?
Voici ce qu’écrivait précisément Jacques ATTALI, le 3 mai 2009, dans la foulée du déclenchement de l’épidémie de Grippe A (H1N1) et quelques mois après le krach financier d’octobre 2008, dans sa rubrique du magazine L’Express :
« L’Histoire nous apprend que l’humanité n’évolue significativement que lorsqu’elle a vraiment peur : elle met alors d’abord en place des mécanismes de défense ; parfois intolérables (des boucs émissaires et des totalitarismes) ; parfois futiles (de la distraction) ; parfois efficaces (des thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs). Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique.
La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. »[li]
Et partant de l’observation des conséquences de la grippe aviaire de 2003, il décrit, en les amplifiant, celles qu’aurait pu provoquer la Grippe A :
« Si elle n’est pas plus grave que les deux précédentes peurs liés à un risque de pandémie (la crise de la vache folle de 2001 en Grande Bretagne et celle de la grippe aviaire de 2003 en Chine), elle aura d’abord des conséquences économiques significatives (chute des transports aériens, baisse du tourisme et du prix du pétrole ) ; elle coûtera environ deux millions de dollars par personne contaminée et fera baisser les marchés boursiers d’environ 15% ; son impact sera très bref (le taux de croissance chinois n’a baissé que pendant le deuxième trimestre de 2003, pour exploser à la hausse au troisième) ; elle aura aussi des conséquences en matière d’organisation (en 2003, des mesures policières très rigoureuses ont été prises dans toute l’Asie ; l’Organisation Mondiale de la Santé a mis en place des procédures mondiales d’alerte ; et certains pays, en particulier la France et le Japon, ont constitué des réserves considérables de médicaments et de masques).
Si elle est un peu plus grave, ce qui est possible, puisqu’elle est transmissible par l’homme, elle aura des conséquences véritablement planétaires : économiques (les modèles laissent à penser que cela pourrait entrainer une perte de trois trillions de dollars, soit une baisse de 5% du PIB mondial) et politiques… »
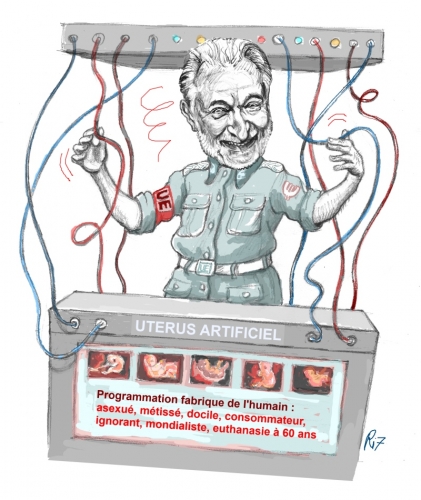
Ce scénario catastrophe permettrait in fine, selon ATTALI, d’établir un gouvernement mondial :
« Et, même si, comme il faut évidemment l’espérer, cette crise n’est très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d’en tirer les leçons, pour qu’avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle et des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l’aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d’un véritable gouvernement mondial. C’est d’ailleurs par l’hôpital qu’a commencé en France au 17ème siècle la mise en place d’un véritable Etat.
En attendant, on pourrait au moins espérer la mise en œuvre d’une véritable politique européenne sur le sujet. Mais là encore, comme sur tant d’autres sujets, Bruxelles est muet. »
Le gouvernement mondial est une utopie. Les utopies ne se réalisent jamais, mais elles produisent, au cours et à la suite de leur tentative de réalisation, souvent beaucoup de souffrances.
Ce projet d’établissement d’un gouvernement mondial tire ses racines du messianisme biblique. Jacques ATTALI, messianiste revendiqué et chantre pour la France de ce projet d’essence religieuse attend cette ère eschatologique depuis bien des années. En 2010, il déclarait sur la chaîne de télévision Public Sénat qu’il rêvait de voir Jérusalem devenir « la capitale de la planète qui sera un jour unifiée autour d’un gouvernement mondial »[lii].
J’ai consacré plusieurs ouvrages – parmi lesquels Occident & Islam Tome I et Tome II – aux origines antiques et aux phases de développement médiévales et modernes de ce messianisme vétérotestamentaire ; je n’y reviendrai donc pas ici car cela nous emmènerait trop loin.
Je rappellerai simplement que le « gouvernement mondial » est un des multiples noms – à l’instar de « La dictature du prolétariat », « La République universelle », « La Fin de l’histoire et le Dernier Homme »… – de ce qui correspond, dans ce messianisme, à l’effondrement de l’Histoire laissant place à un monde qui est un mélange d’Eden terrestre (décrit dans le premier livre de la Torah, la Genèse) rétabli et d’utopie jamais connue.
Ces temps messianiques doivent être précédés de grandes catastrophes. Des calamités qui, si elles ne sont produites par le cours naturel de l’histoire, doivent être, du point de vue des messianistes, provoquées, afin de « hâter la venue du Messie ». Pour ceux qui ne sont pas familiers de ces notions, je citerai quelques lignes du plus grand historien du judaïsme et du messianisme, Gershom Scholem (1897-1982) :
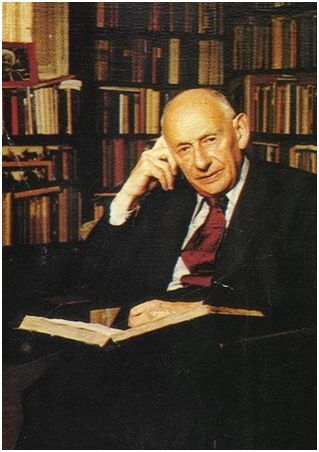 « Pour les prophètes et les maîtres de l’Aggada (l’Aggada désigne les enseignements rabbiniques non-législatifs) la rédemption devait se produire par suite d’un bouleversement général, d’une révolution universelle, de catastrophes, de calamités inouïes en vertu desquelles l’histoire devait s’effondrer et s’éteindre. L’histoire était considérée par eux avec le pessimisme le plus absolu… Pour aboutir à la délivrance, il est nécessaire que l’édifice actuel soit abattu pour faire place à l’édifice messianique… »[liii]
« Pour les prophètes et les maîtres de l’Aggada (l’Aggada désigne les enseignements rabbiniques non-législatifs) la rédemption devait se produire par suite d’un bouleversement général, d’une révolution universelle, de catastrophes, de calamités inouïes en vertu desquelles l’histoire devait s’effondrer et s’éteindre. L’histoire était considérée par eux avec le pessimisme le plus absolu… Pour aboutir à la délivrance, il est nécessaire que l’édifice actuel soit abattu pour faire place à l’édifice messianique… »[liii]
Les messianistes conscients – comme ceux qui s’ignorent mais dont l’espérance messianique est logée au tréfonds de leur inconscient – voient dans chaque grande catastrophe, ou ce qui est désigné comme telle, un de ces événements prophétiques et apocalyptiques précédents la fin de l’Histoire et l’établissement du paradis terrestre.
Ainsi, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Albert Einstein écrivait en novembre 1945 dans la revue Atlantic Monthly : « Puisque pour l’instant seuls les États-Unis et la Grande-Bretagne possèdent le secret de la bombe atomique, il reviendrait naturellement à ces pays d’inviter l’Union soviétique à préparer et présenter le premier projet de constitution d’un gouvernement mondial… Un gouvernement mondial tel que je le conçois devrait être compétent pour juger de toute affaire militaire. Outre cette compétence, je ne lui donnerais qu’un seul pouvoir, celui de s’ingérer dans les affaires intérieures d’un État dans le cas où une minorité opprimerait la majorité des hommes du pays, créant ainsi un climat d’instabilité pouvant conduire à une guerre. »
Dans un autre texte paru deux mois plus tard, en janvier 1946 dans le Survey Graphic, Einstein revient sur cette idée : « Le désir de paix de l’humanité ne pourra se réaliser que par la création d’un gouvernement mondial. »[liv]
Aujourd’hui, la crise du coronavirus, présentée par certains comme l’équivalent d’une guerre mondiale, offre un nouveau prétexte aux messianistes pour tenter de faire aboutir leur projet.
Le journal britannique The Guardian a publié le 26 mars 2020 un article titré « Gordon Brown calls for global government to tackle coronavirus » (Gordon Brown appelle à un gouvernement mondial pour combattre le coronavirus). On y lit les propos tenus par l’ancien Premier ministre (travailliste) de Grande-Bretagne, Gordon Brown, qui « a exhorté les dirigeants mondiaux à créer une forme temporaire de gouvernement mondial pour faire face à la double crise médicale et économique causée par la pandémie de Covid-19. »[lv]
L’ex premier ministre a déclaré que la crise actuelle était différente – en ce qu’elle nécessiterait une solution globale – de celle à laquelle il a fait face, à savoir la crise financière de 2008 où il s’était illustré en « persuadant » les dirigeants mondiaux de la nécessité de renflouer les banques (avec l’argent des peuples), puis a organisé une réunion du G20 à Londres, qui a abouti à un plan de sauvetage du système bancaire.
De la même façon, Henry Kissinger (ancien secrétaire d’État et ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis), qui a été l’un des hommes les plus influents du système impérial américain, a publié le 3 avril 2020 dans le Wall Street Journal un texte titré « The Coronavirus Pandemic Will Forever After the World Order » (La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l’ordre mondial) où il plaide pour l’établissement d’un gouvernement mondial en réponse au coronavirus.
Usant de la même rhétorique qu’ATTALI et Brown, consistant à faire accepter le projet globaliste par la peur que suscitent les catastrophes successives, KISSINGER débute son texte, par une analogie, à dessein, entre la Seconde Guerre mondiale et le coronavirus :
« L’atmosphère surréaliste de la pandémie de Covid-19 me rappelle ce que j’ai ressenti lorsque j’étais jeune homme dans la 84e division d’infanterie pendant la bataille des Ardennes. Aujourd’hui, comme à la fin de 1944, il existe un sentiment de danger imminent, qui ne vise pas une personne en particulier, mais qui frappe au hasard et avec dévastation. Mais il y a une différence importante entre cette époque lointaine et la nôtre. L’endurance américaine était alors fortifiée par un objectif national ultime. Aujourd’hui, dans un pays divisé, un gouvernement efficace et clairvoyant est nécessaire pour surmonter des obstacles sans précédent en termes d’ampleur et de portée mondiale… »
Et d’après Monsieur Kissinger, le gouvernement américain, solidifié, devra conduire le monde vers un État planétaire pour triompher face au Covid-19 :
« Aucun pays, pas même les États-Unis, ne peut, dans un effort purement national, vaincre le virus… Si les États-Unis, dans leurs efforts pour reconstruire leur propre économie, ne font pas les premiers pas vers la création d’un gouvernement mondial, l’humanité est condamnée. »[lvi]
Nous voyons bien là qu’il existe, à travers les décennies et au-delà, une communion de pensée entre les différents représentants de l’oligarchie occidentale, d’Einstein à Kissinger en passant par Attali. Le même catastrophisme apocalyptique, la même espérance messianique, la même rhétorique et la même attitude aujourd’hui face au coronavirus.
L’essayiste Naomi Klein a baptisé la stratégie de l’oligarchie « doctrine du choc », c’est-à-dire : « la stratégie politique consistant à utiliser les crises à grandes échelle pour faire avancer des politiques qui approfondissent systématiquement les inégalités, enrichissent les élites et affaiblissent les autres. »[lvii]
C’est une analyse marxiste, économico-matérialiste – qui est un des aspects, par définition partiel et incomplet, du phénomène historique – de ce que j’appelle le catastrophisme apocalypto-messianique. Le messianisme biblique est un projet global qui embrasse toutes les dimensions, l’économie est une parmi d’autres.
J’ai déjà eu l’occasion de l’écrire – notamment dans un article du 26 juin 2016[lviii], au lendemain du vote favorable au Brexit – la crise, qu’elle soit provoquée ou non, peut être un moyen, pour une branche de l’oligarchie occidentale, de passer à une étape supérieure. Il s’agit du concept de Karl Marx, le « saut qualitatif » menant à un changement de paradigme. Ce concept est une redéfinition matérialiste d’une conception historique empruntée, consciemment ou non, au messianisme juif.
Mais la pandémie n’est pas la seule catastrophe prévue/attendue/provoquée par l’oligarchie pour faire accoucher, dans la douleur, du gouvernement mondial.
Jacques ATTALI, toujours, lors d’une interview en septembre 2015, faisait part de sa vision des développements à moyen terme. Il ne s’agit en réalité, pas tant de sa vision personnelle, que de l’agenda de l’oligarchie qu’il représente :
« Je pense que l’Europe va devenir un ensemble fédéral avec une zone restreinte à 20 pays environ, avec un parlement, un gouvernement, une armée, un président de l’Eurozone…
Toutes les crises récentes ont entraîné des progrès vers le fédéralisme. Celle de 2008 a accouché de l’Union bancaire. La crise grecque a fait naître le MES (mécanisme européen de stabilité) avec une force de frappe financière de 500 milliards… La crise des réfugiés va entraîner le renforcement d’un outil jusqu’ici méconnu, Frontex, qui va devenir la police commune des pays européens…
La dépression (économique) est aujourd’hui masquée par les banques centrales qui déversent des milliards sur les marchés. Mais c’est de l’argent imaginaire. Les gouverneurs des banques centrales sont des Madoff qui ne vont pas en prison. Je ne leur reproche rien car ils laissent théoriquement le temps aux hommes politiques de créer un État de droit planétaire.
Je confirme les cinq étapes que j’avais décrites dans « Brève Histoire d’avenir» : déclin de l’empire américain, tentative ratée des autres gouvernements de s’unir pour gouverner le monde, gouvernement du monde par les marchés, guerre mondiale et enfin état de droit mondial. Nous sommes à la fin de la deuxième étape. À ce stade on court droit vers une guerre mondiale en 2035. Mais on peut toujours l’éviter. »[lix]
En résumé, d’après la vision historique et vétérotestamentaire de l’oligarchie messianiste, le monde ne sera finalement pacifié, unifié et l’Eden terrestre instauré, qu’après être passé par plusieurs catastrophes, dont les principales sont : la crise financière, la pandémie et la guerre mondiale.
Et vraisemblablement l’oligarchie globaliste se prépare sérieusement à l’éventualité d’une guerre nucléaire. En juin 2006[lx] avait débuté la construction d’un bunker dans l’Arctique, à Svalbard (Norvège). Il s’agit d’une immense chambre forte construite pour préserver la diversité végétale de la planète : plusieurs millions d’échantillons de graines récoltées dans les 1 400 banques de gènes à travers le monde.
L’Arche en question est une installation fortifiée qui comprend un long tunnel d’une centaine de mètres de long qui débouche sur trois grandes alcôves. Les graines y reposent dans des sachets hermétiques alignés sur des étagères métalliques. La partie visible se limite à l’entrée qui émerge de la montagne enneigée. Celle-ci est constituée de deux hautes parois surmontées d’une œuvre d’art conçue pour être visible à des kilomètres à la ronde dans l’obscurité permanente. Le bunker comprend des portes blindées, des caméras de surveillance, des parois en béton armé de plus d’un mètre d’épaisseur, le tout protégé par la roche de la montagne qui permet en théorie de résister aux tremblements de terre et, selon leur concepteur, à une attaque nucléaire directe ou à une chute d’avion.

© Mari Tefre / Global Crop Diversity Trust – Licence : CC BY-NC-SA
Elle a été baptisée « l’Arche de Noé végétale » en référence au récit biblique. L’Arche de Noé végétale a été inaugurée le 26 février 2008 par José Manuel Barroso alors président de la Commission européenne (de 2004 à 2014, pour être ensuite embauché par la banque judéo-américaine Goldman Sachs en tant que président non exécutif du conseil d’administration), qui l’a décrite, toujours en référence à la Bible, comme « un jardin d’Eden glacé »[lxi], et d’ajouter, durant son discours : « nous espérons et œuvrons pour le meilleur, mais nous devons nous préparer au pire. »[lxii]
Le nom officiel du projet est « Svabald Global Seed Vault », alors que les partenaires qui y collaborent l’appellent entre eux « le coffre-fort du Jugement dernier » (doomsday vault).
Les investisseurs derrière le projet et les opérations de l’Arche sont bien connus. Dans un communiqué le Réseau Semences Paysannes souligne que ce projet est le fruit d’un accord tripartite entre le gouvernement norvégien, « Global Crop Diversity Trust » et la « Nordic Gene Bank ». Le « Trust » est financé et soutenu par Bill Gates[lxiii], via sa Fondation Bill et Melinda Gates, La Fondation Rockefeller, Syngenta AG, Dupont/Pioneer, Monsanto, et la Fédération Internationale des Semences, les plus importants acteurs et lobbyistes de l’industrie des semences.
Or, ces structures ne sont pas réputées pour favoriser la diversité génétique et l’accès aux ressources vivantes actuelles. Selon le Réseau Semences Paysannes, « elles imposent partout des lois qui remettent en cause les droits des paysans de conserver, utiliser, échanger et vendre les semences reproduites à la ferme (…) Elles les obligent ainsi à acheter celles de l’industrie, seules à pouvoir être inscrites dans les catalogues officiels requis pour toute vente. Dans de nombreux pays, les paysans n’ont même plus le droit de ressemer leur récolte. » De plus, « elles généralisent la culture des organismes génétiquement modifiés (OGM) par des stratégies commerciales agressives mettant en danger la diversité des semences fermières. »
Il existe déjà des banques de semences à travers le monde qui conservent en plusieurs exemplaires les graines si précieuses. Les concentrer en un seul endroit, si les autres devaient fermer pour une raison ou pour une autre (la banque de gènes d’Alep, en Syrie, a été détruite durant la guerre[lxiv]), pourrait au contraire augmenter considérablement le risque que ce projet cherche à prévenir officiellement[lxv].
Et on apprend qu’en pleine crise du coronavirus, début mars 2020, l’Arche a reçu une importante livraison de graines alors qu’on nous annonce que la pandémie de coronavirus pourrait entraîner une pénurie de nourriture à l’échelle planétaire. L’Arche de Noé végétale doit, à terme, accueillir deux ou trois millions d’échantillons pour « rendre l’avenir de l’alimentation de l’homme encore plus sûr ».[lxvi]
Quand la réalité dépasse le complotisme…
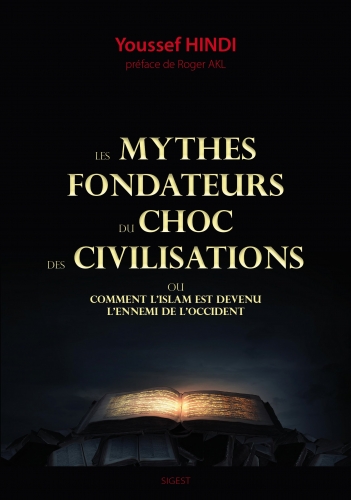 Strategika – Comment liez-vous la crise actuelle à votre domaine d’expertise et votre champ de recherche ? Comment voyez-vous l’évolution de la pandémie et ses conséquences politiques et sociales dans les semaines à venir ?
Strategika – Comment liez-vous la crise actuelle à votre domaine d’expertise et votre champ de recherche ? Comment voyez-vous l’évolution de la pandémie et ses conséquences politiques et sociales dans les semaines à venir ?
Mes champs de recherches sont l’histoire des religions, des idéologies, leurs influences politiques et géopolitiques. Mes travaux, ma réflexion et mes écrits sont en bonne part consacrés à la prospective, c’est-à-dire à l’anticipation des évènements socio-politiques et de l’évolution des grandes tendances historiques.
Comme je l’ai dit récemment à l’occasion d’une autre interview[lxvii], faire de la prospective, visuellement, c’est comme prolonger les courbes correspondant à des tendances sur un diagramme.
Cette épidémie accentue certaines tendances idéologiques, politiques, sociales et géopolitiques sur lesquelles j’ai écrit un certain nombre d’articles – réunis dans un ouvrage publié en février 2019 : Du Brexit aux Gilets jaunes (éd. Sigest) – ; à savoir le retour de la nation contre le globalisme, la régression du libre-échange à l’avantage du protectionnisme économique et la multipolarité au détriment de l’unipolarité américaine.
En d’autres termes, la pandémie constitue, non par sa gravité réelle mais par les mesures prises à l’échelle mondiale et leurs effets rétroactifs, une accélération historique.
En tant qu’accélérateur historique de certaines tendances lourdes, le coronavirus est un révélateur, en ce qu’il fait apparaître brusquement à un nombre croissant de gens ce qui leur était invisible à l’œil nu. Il dévoile – c’est le sens du terme grec apocalypse – ces tendances lourdes et l’agenda que l’oligarchie veut précipiter.
L’oligarchie occidentale, et une partie des élites dirigeantes qui exécutent leur agenda, croient, au sens religieux du terme, que le sens de l’Histoire est en leur faveur ; c’est pourquoi ils n’envisagent pas la possibilité d’être pris à revers.
La réalisation au forceps de leur utopie messianique nécessite des moyens considérables qui ne passent pas inaperçus, notamment en raison de la violence économique et sociale que l’arme du confinement engendre.
Dans les différentes phases énumérées par Attali que j’ai cité précédemment, il a mentionné le « gouvernement du monde par les marchés ». Une réalité que le coronavirus fait apparaître.
Par exemple, les puissantes multinationales Google et Apple mettent à disposition des gouvernements les outils nécessaires pour contrôler les populations, sous prétexte de combattre la pandémie. Google a lancé une plateforme qui permet de visualiser, grâce à la localisation des utilisateurs, le degré de respect du confinement dans les différents pays. Un outil qui collecte déjà les données des internautes dans 131 pays. Le site d’information américain The Verge explique que cette plateforme « utilise les données stockées dans les smartphones pour comprendre le degré d’adhésion des citoyens aux consignes de confinement données par les gouvernements. »[lxviii]
Le 10 avril 2020 Apple et Google ont conjointement annoncé un partenariat pour permettre le suivi numérique des individus ayant été à proximité des personnes infectées par le coronavirus. Les deux géants ont indiqué dans un billet de blog :
« Google et Apple annoncent un effort conjoint pour permettre l’utilisation de la technologie Bluetooth dans le but d’aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus, en intégrant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs au cœur de la conception. »[lxix]
Evidemment, la promesse du respect de la vie privée par Apple et Google ne vaut strictement rien.
 Ryan Calo, chercheur à l’université de Washington et affilié au Centre pour Internet et la société de Stanford, s’interroge :
Ryan Calo, chercheur à l’université de Washington et affilié au Centre pour Internet et la société de Stanford, s’interroge :
« Il est difficile de savoir quel usage ils comptent faire des données obtenues… S’ils pensent que le suivi numérique des contacts va permettre aux gens d’arrêter la distanciation sociale, je suis sceptique. »[lxx]
Le 19 mars dernier, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a levé l’interdiction sur l’échange et le traitement des informations personnelles des citoyens membres de l’Union européenne, en indiquant que « le RGPD (Règlement général sur la protection des données) permettait aux autorités sanitaires compétentes de traiter les données personnelles dans le contexte d’une épidémie, conformément au droit national et dans les conditions qui y sont fixées ».
Cyrille Dalmon, chercheur associé à l’Institut Thomas More, faisait remarquer, dans un texte du 2 avril 2020[lxxi], que d’ores et déjà, en Pologne, les personnes en quarantaine doivent se prendre en photo chez elles pour prouver via une application qu’elles respectent bien le confinement. L’Italie a également recours à l’utilisation massive de la géolocalisation et du recoupement de données personnelles afin de connaître les personnes qui ont potentiellement été en contact avec des malades. En France, en plus de la loi d’urgence votée le 23 mars, loi d’exception s’il en fut, et des vingt-cinq ordonnances adoptées le 25 mars, le comité CARE (Comité Analyse Recherche et Expertise), chargé de conseiller le gouvernement sur le tracking afin d’identifier les personnes en contact avec celles infectées par le coronavirus, se penche sur « l’opportunité de la mise en place d’une stratégie numérique d’identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées », c’est-à-dire de géolocalisation et de recoupement des données comme en Italie.
Et Cyrille Dalmon de poursuivre : « On doit donc constater lucidement que la lutte contre l’épidémie est l’occasion d’une accélération de la numérisation de nos existences et d’un contrôle accru des pouvoirs publics sur nos vies. La constitution de vastes bases de données, associées à un fichage massif des populations, déjà engagée avant la crise dans tous les États du monde, dont nos États démocratiques, est légitimée par l’urgence sanitaire.
Au risque de choquer, et de déplaire, le parallèle (jugé excessif par certains) avec le système de « crédit social » chinois s’en trouve légitimé en retour, au moins partiellement. Si ce dispositif, consistant en une surveillance généralisée de la population et en l’attribution d’une note au citoyen (bonne s’il est « vertueux », mauvaise s’il est « déviant ») paraît odieux à beaucoup d’entre nous, il faut rappeler qu’il n’est que la mise en commun organisée et systématique par l’État de multiples outils technologiques, le plus souvent inventés et développés en Occident.
On nous rétorquera que les réseaux sociaux (qui collectent tant d’informations sur nous, notre vie, nos habitudes, notre santé, etc.) appartiennent à des entreprises privées et non à l’État. C’est vrai. Mais il n’est pas inutile de rappeler que, dans notre propre pays, des fonctionnaires travaillent depuis plus d’un an avec Facebook à l’élaboration d’une stratégie commune « de lutte contre les contenus haineux », sans que cela émeuve outre mesure. »
Ces mesures ne sont pas temporaires, comme l’a souligné l’historien israélien (bien placé pour en parler) Yuval Noah Harari dans les pages du Financial Times du 19 mars : « Les mesures prises dans l’urgence ont la mauvaise habitude de rester en place même après l’urgence, d’autant qu’il y a toujours de nouvelles menaces. »
L’oligarchie a conscience que l’appauvrissement organisé des peuples va provoquer des remous dans les corps sociaux ; en conséquence il leur faut accentuer le contrôle numérique et la répression en amont pour prévenir et neutraliser toute révolte.
Remarquons au passage que cette « guerre » contre un « ennemi invisible », la pandémie, rappelle la guerre infinie contre cet autre ennemi, le terrorisme, qui a servi de prétexte à la destruction de pays entiers et au renforcement des lois liberticides aux États-Unis comme en Europe[lxxii].
Nous vivons les conséquences de la phase terminale de la fusion historique de deux systèmes apparemment opposés, le capitalisme financier débridé surplombant et contrôlant les États, et le système concentrique de contrôle social soviétique ; les deux ont donné naissance à une sorte de soviéto-capitalisme. La technologie numérique des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon…) au service d’un politburo planétaire (en fait occidental) en gestation.
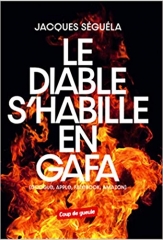 Ce processus de prise de contrôle de l’appareil d’État par les multinationales et le système bancaire est devenu manifeste et grandissant aux États-Unis durant les années Reagan (1981-1989)[lxxiii]. Le phénomène s’est prolongé géographiquement en Europe, via notamment ce « machin » qu’est l’Union européenne – Charles de Gaulle en son temps avait qualifié ainsi l’Organisation des Nation unies : « Le machin qu’on appelle l’ONU »[lxxiv] – qu’il conviendrait d’appeler le Politburo de Bruxelles.
Ce processus de prise de contrôle de l’appareil d’État par les multinationales et le système bancaire est devenu manifeste et grandissant aux États-Unis durant les années Reagan (1981-1989)[lxxiii]. Le phénomène s’est prolongé géographiquement en Europe, via notamment ce « machin » qu’est l’Union européenne – Charles de Gaulle en son temps avait qualifié ainsi l’Organisation des Nation unies : « Le machin qu’on appelle l’ONU »[lxxiv] – qu’il conviendrait d’appeler le Politburo de Bruxelles.
Aux États-Unis comme en Europe, les allers-retours des hauts fonctionnaires, entre les grandes banques (Goldman Sachs, JP Morgan…) et les appareils d’États, les ministères des Finances, le Trésor américain et les institutions (comme la Banque centrale européenne), est en cela tout à fait significatif de ce soviéto-capitalisme. Emmanuel Macron, passé de la banque Rothschild à l’Elysée, est l’archétype de ce système.
L’on peut qualifier également le système chinois de soviéto-capitaliste, à une différence près, et elle est de taille : en Chine, contrairement à l’Occident, le capitalisme est sous le contrôle de l’État. En cela, la Chine est le miroir renversé de l’Occident. Par ailleurs, la crise du coronavirus est aussi un accélérateur et un aggravateur de l’opposition géopolitique États-Unis/Chine. Mais n’oublions pas que l’Occident a involontairement et indirectement créé le système économique de la Chine contemporaine en faisant d’elle son atelier dans le cadre du libre-échange. Les Chinois, champions du mimétisme, ont ainsi copié les technologies occidentales pour monter en gamme – jusqu’en 2010 au moins les industries dont l’investissement était étranger étaient plus productrices que les industries locales[lxxv]. La Chine a finalement retourné l’arme du libre-échange contre l’Occident et accentué la destruction de l’industrie européenne et étasunienne. La Chine a profité d’un système qui est entièrement anglo-américain.
Tout cela étant dit, ce que l’on constate d’ores et déjà avec cette crise pandémique, ce n’est pas un mouvement d’unification de la planète qu’espère Attali et les siens, mais un renforcement de la nation, d’une volonté de relocalisation et une accentuation de la multipolarité.
Le monde est témoin de ce qu’il s’est passé en Italie – pays abandonné par ses voisins de l’UE et aidé par la Chine, la Russie, Cuba… – où le drapeau de l’Union européenne a été retiré par des maires et brûlé par nombre de citoyens italiens. La colère et les critiques contre l’UE et l’Allemagne sont même venues d’hommes politiques et journaux italiens qui sont en temps normal des européistes convaincus[lxxvi].
À cela s’est ajouté l’échec du sommet européen pour résoudre la crise du coronavirus. Le jeudi 26 mars, le sommet réunissant les dirigeants européens s’est terminé avec des insultes. Jean Quatremer, journaliste correspondant à Bruxelles, rapportait :
« Les couteaux sont tirés. Une large majorité d’États ne supportent plus l’égoïsme et la morgue du ‘‘club des radins’’ (Allemagne, Finlande et Pays-Bas). ‘‘Leur comportement de châtelain européen s’adressant à leurs sujets est insupportables’’, grince-t-on à Paris. Le demi-échec du sommet des chefs d’État et de gouvernement, jeudi soir, Berlin et ses alliés s’étant opposés à la création d’un ‘‘instrument de dette commun’’, a fait sauter le couvercle des rancœurs accumulées. »
Le ministre néerlandais, Wopke Hoekstra a demandé à la Commission européenne d’enquêter sur les raisons de l’absence de marge de manœuvre budgétaire de certains pays pour faire face à la crise du coronavirus. En réponse, le lendemain matin du sommet, Antonio Costa, Premier ministre portugais, a réagi en dénonçant violemment son attitude « répugnante » :
« C’est d’une inconscience absolue et cette mesquinerie récurrente mine totalement ce qui fait l’esprit de l’Union et représente une menace pour son avenir. »[lxxvii]
Aux États-Unis, le coronavirus accentue encore la lutte – que j’analyse depuis plusieurs années – entre les factions qui se partagent le pouvoir : pour aller vite les souverainistes protectionnistes contre les globalistes. À titre d’exemple, Donald Trump a annoncé, le 14 avril 2020, qu’il suspendait la contribution des États-Unis au budget de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est, comme je l’ai écrit plus haut, sous le contrôle de Bill Gates et des multinationales pharmaceutiques. Le président américain accuse l’OMS d’avoir commis de nombreuses « erreurs » dans sa gestion de l’épidémie. Il a précisé qu’il coupait les vivres de l’OMS, que les États-Unis financent à hauteur de 400 à 500 millions de dollars par an, le temps qu’une étude soit menée « pour examiner le rôle (de l’OMS) dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus », ce qui pourrait prendre entre 60 et 90 jours[lxxviii].
Le président américain a, dans un premier temps, été réticent à confiner la population, et il a manifestement été dubitatif face à la narration officielle occidentale concernant la dangerosité du coronavirus. Durant une conférence de presse à la Maison Blanche le 4 avril dernier, Donald Trump, s’est ainsi exprimé sur le coronavirus :
« Nous irons mieux, et nous irons mieux très vite. Ceci a été artificiellement induit. Ils ont dit ‘‘fermez le pays, nous devons fermez le pays’’, et nous avons fermé le pays. Et nous guérissons, et nous irons mieux très vite. »[lxxix]

Le coronavirus a aggravé une autre lutte, qui oppose depuis deux ans[lxxx] Donald Trump et la FED (Réserve fédérale), la banque centrale étasunienne contrôlée par le cartel bancaire. Alors que le coronavirus perturbait les marchés, le président américain a attaqué publiquement le président de la FED, Jerome Powell, dans un tweet du 10 mars :
« Notre Réserve fédérale minable et lente, dirigée par Jay Powell, qui a relevé les taux trop rapidement et (les a) baissés trop tard, devrait ramener notre taux directeur aux niveaux de ceux de nos pays concurrents. »
Le taux directeur influence directement le prix du crédit octroyé par les banques privées qui répercutent les taux de la banque centrale. Des taux directeurs faibles peuvent aussi signifier que les intérêts sur les produits d’épargne sont moins élevés car les paiements des taux d’intérêt perdent de la valeur[lxxxi]. Le taux bas, est bon pour le foyer et l’entreprise, et le taux élevé est à l’avantage du banquier et du vendeur. En clair, si la FED relève trop haut son taux directeur, cela a un impact négatif sur l’économie réelle. Et comme je le disais plus haut, le projet, selon moi, des financiers internationaux, est de détruire l’économie réelle, appauvrir les classes moyennes et inférieures, en tondant aux passages les épargnants.
L’opposition entre Trump et la FED c’est au fond l’opposition entre l’économie réelle, industrielle, et l’économie fictive, la finance, la banque.
Par ailleurs, rapporte le New York Times[lxxxii] – qui défend ouvertement la FED contre le président des États-Unis -, Donald Trump a menacé de remplacer Jerome Powell ; ce qui reviendrait à placer sous le contrôle de la Maison Blanche la politique monétaire des États-Unis. Ce serait une déclaration de guerre envoyée au système bancaire.
Pour résumer : la crise du coronavirus va accentuer l’opposition entre, d’une part le globalisme, la finance mondiale, et l’impérialisme unipolaire, et d’autre part le souverainisme, le protectionnisme économique et la multipolarité géopolitique.
Strategika – Existe-t-il une issue politique à la situation que vous venez de décrire et quelle forme pourrait-elle prendre selon vous ?
Il n’y a pas de réponse unique à cette question, car si l’on peut, comme je viens de le faire à grands traits, analyser et anticiper les tendances de fond et les confrontations politico-idéologiques, l’issue politique variera en fonction du pays. Je me concentrerai donc ici sur la France.
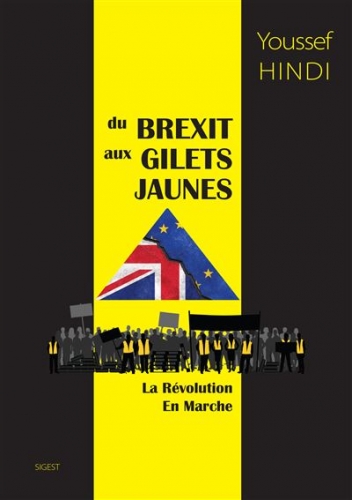 Si mon modèle d’analyse prospectiviste est efficient et mon concept « coronavirus : accélérateur historique » valide, nous verrons en France, comme dans le reste du monde, une accélération des processus en cours depuis quelques années (je renvoie à mon ouvrage Du Brexit aux Gilets jaunes).
Si mon modèle d’analyse prospectiviste est efficient et mon concept « coronavirus : accélérateur historique » valide, nous verrons en France, comme dans le reste du monde, une accélération des processus en cours depuis quelques années (je renvoie à mon ouvrage Du Brexit aux Gilets jaunes).
Parmi ces processus, il y a la destruction de la classe moyenne, que le géographe Christophe Guilluy a décrite dans son ouvrage No Society. La fin de la classe moyenne occidentale (2018). C’est ce qui explique le comportement de la finance internationale, que j’ai exposé plus haut, vis-à-vis des épargnants (appartenant à la classe moyenne et à la bourgeoisie) et la déconstruction d’une partie du code du travail et des acquis sociaux par le gouvernement français qui profite de « l’état d’urgence sanitaire »[lxxxiii]. Politique d’appauvrissement volontaire du peuple français (les patrons de PME comme les employés, les ouvriers etc…) par la mise à l’arrêt, par le confinement, de l’économie nationale au prétexte de la lutte contre la pandémie.
Alors que, en plein coronavirus, l’Agence régionale de santé (ARS) confirme la suppression de 600 postes à l’hôpital de Nancy[lxxxiv], le Ministère de l’Intérieur a publié un appel d’offre (le 3 mars 2020) d’un montant de 3 642 864 euros pour l’achat de gaz lacrymogène[lxxxv], suivi d’un autre appel d’offre (le 12 avril 2020), toujours du Ministère de l’Intérieur, d’un montant de quatre millions d’euros pour l’achat de plusieurs centaines de drones destinés à la surveillance de la population[lxxxvi].
Il ne s’agit plus là d’un simple « flash totalitaire » (pour reprendre le concept d’un historien et démographe médiatique qui analysait l’épisode « Charlie »[lxxxvii]) mais d’une volonté de l’oligarchie, via sa courroie de transmission, le gouvernement de Macron, de détruire et soumettre la société tout entière à une dictature bancaire.
Mais cela peut produire l’effet contraire à celui souhaité par le pouvoir. Cette politique de confinement/appauvrissement pourrait conduire à une révolte d’ampleur plus large que celle des Gilets jaunes, par la jonction de la France périphérique (que représentent les Gilets jaunes) et des classes moyennes.
J’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, notamment lors d’une conférence donnée chez les Gilets jaunes de Cannes[lxxxviii] : l’une des conditions nécessaires pour transformer une révolte en révolution, c’est le couplage de la France périphérique et des classes moyennes, et une partie de la bourgeoisie. Et la destruction de l’économie par le confinement va bien évidemment atteindre la bourgeoisie – à plus forte raison si son épargne est ponctionnée – et pourrait, si elle n’est pas retenue par une prudence malencontreuse, être conduite à rejoindre les révoltés de la France périphérique.
D’ailleurs, selon des notes confidentielles (datées du 7, 8 et 9 avril) sur le « suivi de l’impact du Covid-19 » que le journal Le Parisien a pu consulter, le service central du renseignement territorial (SCRT) redoute une radicalisation de la contestation sociale à l’issue du confinement[lxxxix]. Les agents du SCRT analysent ainsi les informations en leur possession :
« Le jour d’après est un thème fortement mobilisateur des mouvances contestataires. Le confinement ne permet plus à la gronde populaire de s’exprimer, mais la colère ne faiblit pas et la gestion de crise, très critiquée, nourrit la contestation. »
Le Parisien souligne que lors des grèves de novembre contre la réforme des retraites, des rapprochements avaient déjà été observés entre « Gilets jaunes radicalisés » et « cheminots irréductibles ». Les agents de la SCRT s’alarment de l’agitation des groupuscules « d’extrême gauche » et de « l’ultra droite » ; or, le danger pour le pouvoir ne viendra certainement pas de là, mais plutôt d’une massification de la révolte. La neutralisation voire la manipulation de ces groupuscules n’a jamais constitué un défi ou une difficulté pour les services de renseignement…
Dans l’attente de la sortie du confinement, les agents du renseignement anticipent « la création de comités de lutte entre personnes d’un même immeuble » ainsi « qu’une organisation commune à distance ».
Neutraliser un peuple entier voulant sortir du confinement pour empêcher sa réduction en esclavage est une autre paire de manches que de s’occuper de quelques groupes marginaux et résiduels. L’État policier peut s’illustrer dans la répression de dizaines de milliers de Gilets jaunes, mais dans le contexte actuel, il est inexistant, il lui est impossible de maîtriser l’ensemble de la population. En clair, les 67 millions de personnes qui sont assignées à résidence, ne le sont pas par contrainte, mais parce qu’elles y ont consenti. Pour combien de temps encore ? S’il venait à l’esprit des Français, collectivement, de braver le confinement, ils s’apercevraient que nous sommes face à un État policier virtuel, un État policier sans policier. La police n’étant omniprésente qu’à la télévision.
Par conséquent, en essayant de soumettre la société, les dirigeants sont peut-être bien en train de fabriquer involontairement un Golem incontrôlable, fait de la fusion des colères, et qui se retournerait contre eux. Ils provoqueraient alors un flash totalitaire inversé qui ferait s’abattre sur ces élites dirigeantes un terrifiant courroux.
Youssef Hindi
Le 18/04/2020
[i] https://google.com/covid19-map/?hl=fr
[ii] https://www.liberation.fr/france/2020/02/28/la-grippe-sai...
[iii] https://strategika.fr/2020/03/29/coronavirus-italie-le-pr...
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-70-d-hommes-...
[iv] https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2622115...
[v] http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e...
[vi] https://strategika.fr/2020/04/08/10-experts-medicaux-de-p...
[vii] Une commande initiale d’un montant de 712 millions d’euros qui avait fait scandale et poussé R. Bachelot à annuler la commande de 50 millions (sur les 94 millions commandés) de doses de vaccins, environ la moitié. https://www.liberation.fr/societe/2010/01/05/grippe-h1n1-...
[viii] https://sante.lefigaro.fr/actualite/2010/10/14/10475-vacc...
[ix] Anciennement ICI PHARMA, puis ZENECA GROUP, avant son rachat par le groupe suédois Astra AB pour former enfin Astra Zeneca le 6 avril 1999. https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2...!
[x] https://www.fakirpresse.info/Le-vrai-CV-de-Roselyne-Bache...
[xi] http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cegrippea/09-10/
[xii] https://www.liberation.fr/societe/2010/01/05/grippe-h1n1-...
[xiii] https://strategika.fr/2020/03/30/douze-experts-sinterroge...
[xiv] https://www.marianne.net/societe/la-chloroquine-guerit-le...
[xv] https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U&t=6s
[xvi] David Graeber, Dette : 5 000 ans d’histoire, New York, 2011, traduction française 2013, Éditions Les Liens qui libèrent.
[xvii] Jacques Sapir, La Démondialisation, Le Seuil, 2011, p. 105.
[xviii] https://www.diploweb.com/2020-Vers-une-nouvelle-crise-fin...
[xix] https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-a-wall-stre...
[xx] IMF’s Christine Lagarde : « When The World Goes Downhill, We Thrive », Zerohedge.com, 2 avril 2016.
[xxi] James K. Galbraith, L’État prédateur, Le Seuil, 2009.
[xxii] Jacques Sapir, La Démondialisation.
[xxiii] https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/03/23/coronavi...
[xxiv] https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/03/23/coronavi...
[xxv] https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/09/20002-2013...
[xxvi] https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/19/taxe-s...
[xxvii] https://www.challenges.fr/economie/la-zone-euro-prend-un-...
[xxviii] https://www.huffingtonpost.fr/2013/10/10/fmi-taxe-epargne...
[xxix] Karl Marx, La lutte des classes en France, 1850.
[xxx] https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/15/q...
[xxxi] https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronaviru...
[xxxii] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-05/spanis...
[xxxiii] https://www.courrierinternational.com/article/vu-dallemag...
[xxxiv] https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/
[xxxv] https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/cor...
[xxxvi] https://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/ce-que-l-etat-...
[xxxvii] https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualite...
[xxxviii] L’État français a « investi » de pseudo-fonds-propres – en réalité il s’agissait d’un prêt sur cinq ans. Un prêt donc, à hauteur de 10,5 milliards d’euros accordé à six banques (BNP Paribas, Crédit Agricole, Banque populaires, Crédit Mutuel, Société Générale, Caisse d’épargne), qui ne donnait par conséquent à l’État français aucun pouvoir décisionnel. Cf. Frédéric Lordon, La crise de trop, Fayard, 2009, pp. 127-128.
[xxxix] https://www.franceculture.fr/histoire/quand-le-pere-de-ma...
[xl] https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/pourquoi-l...
[xli] https://www.lefigaro.fr/flash-actu/etats-unis-quatre-etat...
[xlii] https://lareleveetlapeste.fr/loms-controle-multinationale...
[xliii] https://www.youtube.com/watch?v=N-mL9gX9gws
[xliv] https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200409.O...
[xlv] https://www.nytimes.com/2020/03/17/world/europe/coronavir...
[xlvi] https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200403.O...
[xlvii] https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200409.O...
[xlviii] https://research.pasteur.fr/en/member/simon-cauchemez/
[xlix] Christophe Fraser, Christl A. Donnelly, Simon Cauchemez et William P. Hanage, « Pandemic Potential of a Strain of Influenza A (H1N1): Early Findings », Science, vol. 324, no 5934, 19 juin 2009, p. 1557–1561.
[l] S Cauchemez, M Ledrans, C Poletto et P Quenel, « Local and regional spread of chikungunya fever in the Americas », Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, vol. 19, no 28, 17 juillet 2014, p. 20854.
[li] https://blogs.lexpress.fr/attali/2009/05/03/changer_par_p...
[lii] Lors d’une interview diffusée sur Public Sénat le 14 septembre 2010.
[liii] Gershom Scholem, Le messianisme juif, Calmann-Lévy, Presses Pocket, 1992, p. 34.
[liv] Albert Einstein, Le Pouvoir nu, Propos sur la guerre et la paix, Hermann, 1991.
[lv] https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-b...
[lvi] https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-wil...
[lvii] https://zintv.org/naomi-klein-comment-lelite-mondiale-va-...
[lviii] Youssef Hindi, « Brexit, opportunité historique ou piège de l’oligarchie », Arrêt-sur-Info, 26/06/2016.
[lix] https://www.parismatch.com/Actu/Economie/Jacques-Attali-O...
[lx] https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/terre-...
[lxi] https://www.nouvelobs.com/planete/20080226.OBS2388/une-ar...
[lxii] https://www.notre-planete.info/actualites/1580-arche_noe_...
[lxiii] https://www.mondialisation.ca/l-arche-de-no-v-g-tale-en-a...
[lxiv] https://fr.metrotime.be/2020/03/01/actualite/arche-de-noe...
[lxv] https://www.notre-planete.info/actualites/1580-arche_noe_...
[lxvi] https://www.capital.fr/economie-politique/quest-ce-que-la...
[lxvii] https://youssefhindi.fr/2020/04/07/entretien-avec-rivarol...
[lxviii] https://www.courrierinternational.com/article/pandemie-go...
[lxix] https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/cor...
[lxx] https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/cor...
[lxxi] http://institut-thomas-more.org/2020/04/02/du-confinement...
[lxxii] https://youssefhindi.fr/2015/12/04/attentats-du-13-novemb...
[lxxiii] James K. Galbraith, L’État prédateur, 2008, Le Seuil, 2009.
[lxxiv] Charles de Gaulle, le 10 septembre 1960 à Nantes.
[lxxv] Jacques Sapir, La Démondialisation, p. 95.
[lxxvi] http://www.slate.fr/story/189210/coronavirus-europe-itali...
[lxxvii] https://www.liberation.fr/planete/2020/03/27/repugnant-ch...
[lxxviii] https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/don...
[lxxix] https://www.msn.com/en-us/video/news/trump-on-coronavirus...
[lxxx] https://www.nytimes.com/2020/03/19/business/economy/fed-p...
[lxxxi] https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economi...
[lxxxii] https://www.nytimes.com/2020/03/19/business/economy/fed-p...
[lxxxiii] https://www.marianne.net/politique/conges-35-heures-licen...
[lxxxiv] https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/en-plein-coronaviru...
[lxxxv] https://blogs.mediapart.fr/avellino/blog/070420/3-mars-3-...
[lxxxvi] https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/15/pourquoi-l...
[lxxxvii] Emmanuel Todd, Qui est Charlie ?, Le Seuil, 2015.
[lxxxviii] https://www.nice-provence.info/2019/08/26/youssef-hindi-c...
[lxxxix] http://www.leparisien.fr/faits-divers/coronavirus-les-ser...




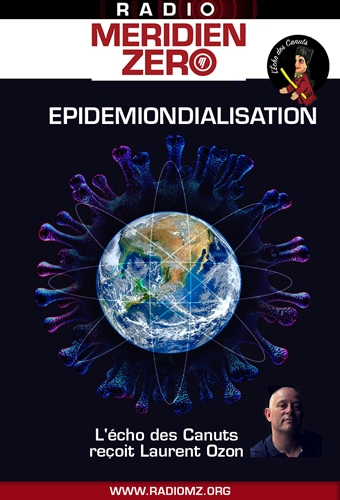

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg

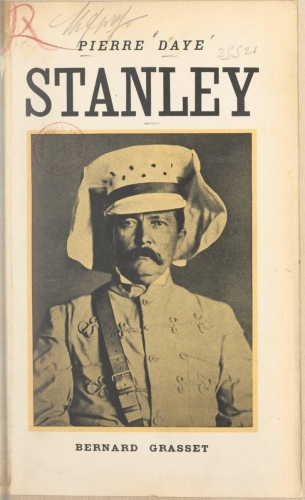 Embauché comme reporter par le grand quotidien Le Soir, il va désormais multiplier les expéditions les plus lointaines et les entrevues exclusives. En une quinzaine d’années, ses pérégrinations vont l’emmener aux quatre coins de l’univers et lui permettre de rencontrer un nombre incroyable de personnalités de premier plan. Après le Congo (où il retournera plusieurs fois), Pierre Daye visite ainsi le Maroc, où il s’entretient avec le sultan Moulay Youssef (1881-1927), les Balkans, où il est reçu par le Premier ministre bulgare Alexandre Tsankov (1879-1959), et l’Argentine, où il se rend, en 1925, en faisant le subrécargue sur un modeste cargo. Après Buenos-Aires, où il se lie avec l’écrivain nationaliste Leopoldo Lugones (1874-1938), il traverse la Cordillière des Andes et découvre le Chili, puis se rend en Uruguay et au Brésil. En 1926, il est à Moscou, approche Léon Trotsky, Leonid Krassine (5) et Maxime Litvinov (6), puis passe par la Pologne et s’y entretient avec Sikorski (7), avant de regagner Bruxelles pour y faire rapport au roi Albert Ier. D’autres expéditions le conduisent en Angola, en Nubie mais aussi au Maroc espagnol, où il rencontre le général Primo de Rivera, et en Asie qu’il visite en qualité de chargé de mission. Après une escale à Ceylan, il passe par les Indes britanniques, la Malaisie, Sumatra, le Japon, la Chine et la Mandchourie. Dans l’Empire du Milieu, il va voir les tombes des Mings, rencontre Pou-yi (8) et obtient une entrevue avec le président Tchang Tso-lin (9). D’une curiosité insatiable, Pierre Daye effectue ensuite un tour du monde par les îles, périple original qui le conduit au Cap Vert, aux Antilles, à Panama, à Tahiti, aux îles Fidji, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Calédonie, en Australie et à Java. Il va sans dire que toutes ces étapes donnent naissance à autant d’articles ou de livres captivants (10). Notre impénitent voyageur connaît également bien Constantinople et le Moyen-Orient. Passé par la Syrie, la Palestine et Jérusalem, il séjourne assez longuement en Égypte (1931), ce qui lui permet de visiter Memphis (avec le peintre Herman Richir), Thèbes, Abou Simbel et le temple d’Edfou.
Embauché comme reporter par le grand quotidien Le Soir, il va désormais multiplier les expéditions les plus lointaines et les entrevues exclusives. En une quinzaine d’années, ses pérégrinations vont l’emmener aux quatre coins de l’univers et lui permettre de rencontrer un nombre incroyable de personnalités de premier plan. Après le Congo (où il retournera plusieurs fois), Pierre Daye visite ainsi le Maroc, où il s’entretient avec le sultan Moulay Youssef (1881-1927), les Balkans, où il est reçu par le Premier ministre bulgare Alexandre Tsankov (1879-1959), et l’Argentine, où il se rend, en 1925, en faisant le subrécargue sur un modeste cargo. Après Buenos-Aires, où il se lie avec l’écrivain nationaliste Leopoldo Lugones (1874-1938), il traverse la Cordillière des Andes et découvre le Chili, puis se rend en Uruguay et au Brésil. En 1926, il est à Moscou, approche Léon Trotsky, Leonid Krassine (5) et Maxime Litvinov (6), puis passe par la Pologne et s’y entretient avec Sikorski (7), avant de regagner Bruxelles pour y faire rapport au roi Albert Ier. D’autres expéditions le conduisent en Angola, en Nubie mais aussi au Maroc espagnol, où il rencontre le général Primo de Rivera, et en Asie qu’il visite en qualité de chargé de mission. Après une escale à Ceylan, il passe par les Indes britanniques, la Malaisie, Sumatra, le Japon, la Chine et la Mandchourie. Dans l’Empire du Milieu, il va voir les tombes des Mings, rencontre Pou-yi (8) et obtient une entrevue avec le président Tchang Tso-lin (9). D’une curiosité insatiable, Pierre Daye effectue ensuite un tour du monde par les îles, périple original qui le conduit au Cap Vert, aux Antilles, à Panama, à Tahiti, aux îles Fidji, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Calédonie, en Australie et à Java. Il va sans dire que toutes ces étapes donnent naissance à autant d’articles ou de livres captivants (10). Notre impénitent voyageur connaît également bien Constantinople et le Moyen-Orient. Passé par la Syrie, la Palestine et Jérusalem, il séjourne assez longuement en Égypte (1931), ce qui lui permet de visiter Memphis (avec le peintre Herman Richir), Thèbes, Abou Simbel et le temple d’Edfou. 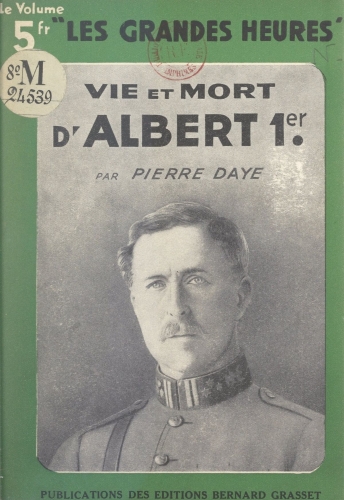 Ajoutons encore à la liste de ses voyages mémorables, la traversée de la Sibérie par 30° au-dessous de zéro, et un séjour en Perse qui lui offre l’occasion de converser avec Reza Chah Pahlavi. Son goût affirmé pour les contrées lointaines ne l’empêche pas d’apprécier aussi les découvertes européennes. Angleterre, Portugal, Italie, Autriche, Hongrie et pays scandinaves n’ont guère de secrets pour lui ; en août 1932, il est même en Lituanie, à Nida, où l’a invité Thomas Mann, tandis qu’en 1935, il visite les Pays-Bas et l’Allemagne en compagnie de Pierre Gaxotte. À Berlin, les deux hommes auront l’occasion d’échanger quelques propos avec Ribbentrop et Otto Abetz. Aventurier dans l’âme, Pierre Daye ne se contente pas de flâner nonchalamment mais il n’hésite pas, le cas échéant, à se rendre sur le théâtre de certains conflits : on le verra par exemple, en pleine guerre civile espagnole, faire la tournée des lignes de front avec Gaxotte et José Félix de Lequerica (11).
Ajoutons encore à la liste de ses voyages mémorables, la traversée de la Sibérie par 30° au-dessous de zéro, et un séjour en Perse qui lui offre l’occasion de converser avec Reza Chah Pahlavi. Son goût affirmé pour les contrées lointaines ne l’empêche pas d’apprécier aussi les découvertes européennes. Angleterre, Portugal, Italie, Autriche, Hongrie et pays scandinaves n’ont guère de secrets pour lui ; en août 1932, il est même en Lituanie, à Nida, où l’a invité Thomas Mann, tandis qu’en 1935, il visite les Pays-Bas et l’Allemagne en compagnie de Pierre Gaxotte. À Berlin, les deux hommes auront l’occasion d’échanger quelques propos avec Ribbentrop et Otto Abetz. Aventurier dans l’âme, Pierre Daye ne se contente pas de flâner nonchalamment mais il n’hésite pas, le cas échéant, à se rendre sur le théâtre de certains conflits : on le verra par exemple, en pleine guerre civile espagnole, faire la tournée des lignes de front avec Gaxotte et José Félix de Lequerica (11).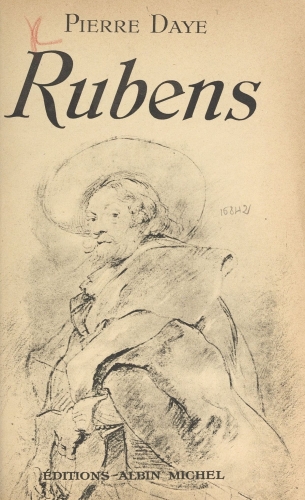 Au demeurant, il serait injuste et inexact de ne voir en Pierre Daye qu’un voyageur nanti et un mondain frivole : il s’agit aussi et surtout d’un écrivain talentueux dont les nombreux livres se vendent très bien. Auteur de multiples récits de voyage (19), il a également consacré plusieurs ouvrages aux souverains belges (20), ainsi que plusieurs essais à l’Afrique (21). Dans la première partie de sa vie, il a, en revanche, peu abordé la politique dans ses livres, et lorsqu’il l’a fait, ce fut plutôt sous l’angle de la politique étrangère (22). Il s’est par ailleurs peu intéressé à la fiction, sinon sous la forme de quelques nouvelles et contes. L’un de ceux-ci, Daïnah, la métisse (1932), sera même adapté au cinéma par Jean Grémillon (avec Charles Vanel dans l’un des rôles principaux).
Au demeurant, il serait injuste et inexact de ne voir en Pierre Daye qu’un voyageur nanti et un mondain frivole : il s’agit aussi et surtout d’un écrivain talentueux dont les nombreux livres se vendent très bien. Auteur de multiples récits de voyage (19), il a également consacré plusieurs ouvrages aux souverains belges (20), ainsi que plusieurs essais à l’Afrique (21). Dans la première partie de sa vie, il a, en revanche, peu abordé la politique dans ses livres, et lorsqu’il l’a fait, ce fut plutôt sous l’angle de la politique étrangère (22). Il s’est par ailleurs peu intéressé à la fiction, sinon sous la forme de quelques nouvelles et contes. L’un de ceux-ci, Daïnah, la métisse (1932), sera même adapté au cinéma par Jean Grémillon (avec Charles Vanel dans l’un des rôles principaux).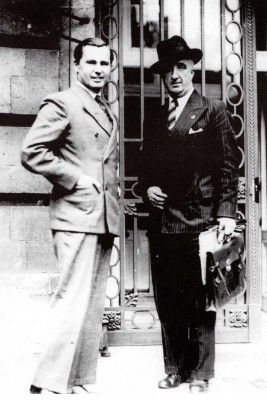 Désireux de descendre dans l’arène pour y défendre ses idées catholiques, sociales et nationales, Pierre Daye découvre en 1935 le nouveau phénomène politique qu’est Léon Degrelle. Le 24 janvier, il le voit, pour la première fois, à Louvain où le jeune orateur l’impressionne beaucoup. « J’attendais depuis plusieurs années », racontera-t-il, « que se manifestât dans mon pays un effet de ce grand mouvement européen dont j’avais découvert en tant de nations les signes tangibles » (24). Séduit, l’écrivain n’est pas long à rejoindre les rangs de Rex où il siège d’emblée au Conseil politique (mais pas au Bureau exécutif). Aux élections du 24 mai 1936, le mouvement, qui a le vent en poupe, obtient du premier coup 33 élus (21 députés et 12 sénateurs). « Nous étions partis, nous pouvons bien le dire », se souvient-il, « sans aucun moyen ; nous n’avions pas d’argent, aucune expérience, très peu d’hommes, pas de journaux. Mais nous avions la foi. Et la jeunesse aussi… » (25). Et le 27 mai, dans les colonnes du Pays réel, le nouveau député bruxellois se montre plus laudatif encore, affirmant entre autres que « Léon Degrelle est devenu l’interprète de tout ce qui, dans la nation, est jeune, vivant, audacieux, tourné vers l’avenir » (26). L’Assemblée que découvre Pierre Daye n’a rien de bien attrayant : selon lui, « les trucs, les combinaisons, l’intérêt personnel, la stérilité, la suffisance, la vulgarité, tels étaient quelques-uns des traits que révélait l’examen de l’institution parlementaire » (27). Il semble néanmoins tout à fait décidé à jouer le jeu et à faire sérieusement son travail de député. Placé à la tête du groupe parlementaire, il s’efforce donc, en premier lieu, de discipliner ses collègues rexistes qui font souvent preuve d’une nonchalance et d’un amateurisme consternants. Auteur d’un projet de loi réduisant la durée du service militaire, il s’exprime aussi au sein de la Commission des Colonies et de celle des Affaires Étrangères où il plaide fougueusement pour l’Espagne nationaliste. Assez proche du chef, il est souvent associé aux grandes manœuvres de ce dernier. En septembre 1936, par exemple, il est aux côtés de Degrelle lorsque celui-ci est reçu par Hitler (invité par Rudolf Hess, il profite du déplacement pour assister au 8e congrès de Nuremberg). C’est par ailleurs autour de la table de Pierre Daye que se nouent certains contacts discrets entre des gens comme Gustave Sap (28), Hendrik Borginon (29), Gérard Romsée (30), Joris van Severen (31), Charles-Albert d’Aspremont-Lynden (32), et Léon Degrelle. Plus tard, et au grand dam du Quai d’Orsay, il demandera la dénonciation de l’accord militaire franco-belge, ainsi que des accords de Locarno (33).
Désireux de descendre dans l’arène pour y défendre ses idées catholiques, sociales et nationales, Pierre Daye découvre en 1935 le nouveau phénomène politique qu’est Léon Degrelle. Le 24 janvier, il le voit, pour la première fois, à Louvain où le jeune orateur l’impressionne beaucoup. « J’attendais depuis plusieurs années », racontera-t-il, « que se manifestât dans mon pays un effet de ce grand mouvement européen dont j’avais découvert en tant de nations les signes tangibles » (24). Séduit, l’écrivain n’est pas long à rejoindre les rangs de Rex où il siège d’emblée au Conseil politique (mais pas au Bureau exécutif). Aux élections du 24 mai 1936, le mouvement, qui a le vent en poupe, obtient du premier coup 33 élus (21 députés et 12 sénateurs). « Nous étions partis, nous pouvons bien le dire », se souvient-il, « sans aucun moyen ; nous n’avions pas d’argent, aucune expérience, très peu d’hommes, pas de journaux. Mais nous avions la foi. Et la jeunesse aussi… » (25). Et le 27 mai, dans les colonnes du Pays réel, le nouveau député bruxellois se montre plus laudatif encore, affirmant entre autres que « Léon Degrelle est devenu l’interprète de tout ce qui, dans la nation, est jeune, vivant, audacieux, tourné vers l’avenir » (26). L’Assemblée que découvre Pierre Daye n’a rien de bien attrayant : selon lui, « les trucs, les combinaisons, l’intérêt personnel, la stérilité, la suffisance, la vulgarité, tels étaient quelques-uns des traits que révélait l’examen de l’institution parlementaire » (27). Il semble néanmoins tout à fait décidé à jouer le jeu et à faire sérieusement son travail de député. Placé à la tête du groupe parlementaire, il s’efforce donc, en premier lieu, de discipliner ses collègues rexistes qui font souvent preuve d’une nonchalance et d’un amateurisme consternants. Auteur d’un projet de loi réduisant la durée du service militaire, il s’exprime aussi au sein de la Commission des Colonies et de celle des Affaires Étrangères où il plaide fougueusement pour l’Espagne nationaliste. Assez proche du chef, il est souvent associé aux grandes manœuvres de ce dernier. En septembre 1936, par exemple, il est aux côtés de Degrelle lorsque celui-ci est reçu par Hitler (invité par Rudolf Hess, il profite du déplacement pour assister au 8e congrès de Nuremberg). C’est par ailleurs autour de la table de Pierre Daye que se nouent certains contacts discrets entre des gens comme Gustave Sap (28), Hendrik Borginon (29), Gérard Romsée (30), Joris van Severen (31), Charles-Albert d’Aspremont-Lynden (32), et Léon Degrelle. Plus tard, et au grand dam du Quai d’Orsay, il demandera la dénonciation de l’accord militaire franco-belge, ainsi que des accords de Locarno (33).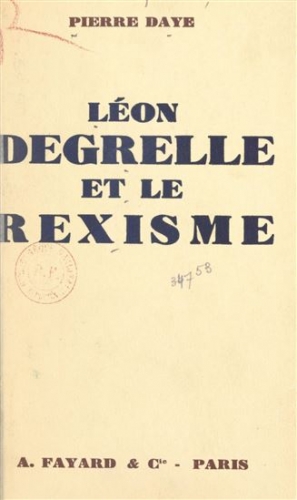 Dévoué mais exigeant, Pierre Daye va vite se lasser des carences profondes du groupe parlementaire rexiste dont il abandonne d’ailleurs la présidence dès juin 1937. Cela ne l’empêche cependant pas de continuer son travail à la Chambre. Dans le même temps, il poursuit son activité de chroniqueur et d’essayiste. En octobre 1936, il joue un rôle clef dans la parution d’un numéro spécial de Je suis partout entièrement consacré à Rex, avec une « Lettre aux Français » de Léon Degrelle et des articles de Serge Doring, Carlos Leruitte et Lucien Rebatet [La même année, Robert Brasillach fait paraître Léon Degrelle et l’avenir de Rex (Plon) et l’année suivante (3 novembre 1937), il dédiera toute une page de Je suis partout au mouvement belge]. Régulièrement présent dans les colonnes de l’hebdomadaire parisien, Pierre Daye signe également, en 1937, un livre sur Léon Degrelle et le rexisme (Fayard), suivi en 1938 d’une Petite histoire parlementaire belge. Malgré cet engagement sans faille, les erreurs répétées de Rex et de son chef finissent toutefois par user sa patience. Ce désenchantement le conduit même, en 1939, à refuser de se représenter aux élections et à quitter le mouvement. Le 10 mars, il prend donc définitivement congé du groupe parlementaire et se tourne dès lors vers le parti catholique où il a conservé nombre d’amis. Il s’en va, certes, mais demeure en excellents termes avec Degrelle, ce que la suite des événements ne va pas tarder à démontrer.
Dévoué mais exigeant, Pierre Daye va vite se lasser des carences profondes du groupe parlementaire rexiste dont il abandonne d’ailleurs la présidence dès juin 1937. Cela ne l’empêche cependant pas de continuer son travail à la Chambre. Dans le même temps, il poursuit son activité de chroniqueur et d’essayiste. En octobre 1936, il joue un rôle clef dans la parution d’un numéro spécial de Je suis partout entièrement consacré à Rex, avec une « Lettre aux Français » de Léon Degrelle et des articles de Serge Doring, Carlos Leruitte et Lucien Rebatet [La même année, Robert Brasillach fait paraître Léon Degrelle et l’avenir de Rex (Plon) et l’année suivante (3 novembre 1937), il dédiera toute une page de Je suis partout au mouvement belge]. Régulièrement présent dans les colonnes de l’hebdomadaire parisien, Pierre Daye signe également, en 1937, un livre sur Léon Degrelle et le rexisme (Fayard), suivi en 1938 d’une Petite histoire parlementaire belge. Malgré cet engagement sans faille, les erreurs répétées de Rex et de son chef finissent toutefois par user sa patience. Ce désenchantement le conduit même, en 1939, à refuser de se représenter aux élections et à quitter le mouvement. Le 10 mars, il prend donc définitivement congé du groupe parlementaire et se tourne dès lors vers le parti catholique où il a conservé nombre d’amis. Il s’en va, certes, mais demeure en excellents termes avec Degrelle, ce que la suite des événements ne va pas tarder à démontrer.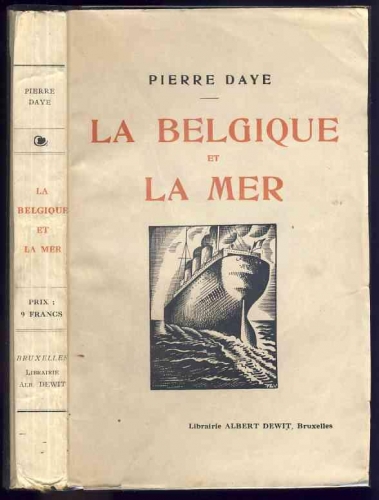 Daye va donc séjourner plusieurs semaines à Saint-Clément-des-Baleines. Loin des combats, il fait de la bicyclette, se balade avec Henri Béraud et aperçoit de temps en temps Suzy Solidor ou le peintre Paul Colin. Cette paisible villégiature s’achève toutefois vers la fin juin car avec l’armistice, le journaliste souhaite désormais rentrer chez lui. Le 8 juillet 1940, il remonte donc sur Paris, s’y arrête le temps de voir Jean Chiappe, puis regagne Bruxelles. Informé du massacre d’Abbeville (36) et du décès de Léon Degrelle, le journaliste ne tarde pas à réapparaître à Paris où l’ambassadeur Abetz, une vieille connaissance, lui apprend incidemment que Degrelle n’est absolument pas mort, mais probablement interné dans un camp du sud de la France. En dépit des divergences politiques qui ont pu opposer les deux hommes, Daye estime alors de son devoir de se porter au secours du chef de Rex et part aussitôt à sa recherche. Accompagné de Jacques Crokaert et Carl Doutreligne, il file à Vichy, rencontre Adrien Marquet mais aussi plusieurs ministres belges en déréliction… L’administration française n’ayant pas mis longtemps à localiser Degrelle qui se trouve dans l’Ariège, au camp du Vernet, le trio de sauveteurs (« mes trois mousquetaires » dira Degrelle dans La cohue de 40) s’empresse de reprendre la route. Quelques heures plus tard, ils sont à Carcassonne où ils retrouvent enfin Léon Degrelle, « sale, amaigri, méconnaissable » (37), ainsi que l’ex-député rexiste Gustave Wyns.
Daye va donc séjourner plusieurs semaines à Saint-Clément-des-Baleines. Loin des combats, il fait de la bicyclette, se balade avec Henri Béraud et aperçoit de temps en temps Suzy Solidor ou le peintre Paul Colin. Cette paisible villégiature s’achève toutefois vers la fin juin car avec l’armistice, le journaliste souhaite désormais rentrer chez lui. Le 8 juillet 1940, il remonte donc sur Paris, s’y arrête le temps de voir Jean Chiappe, puis regagne Bruxelles. Informé du massacre d’Abbeville (36) et du décès de Léon Degrelle, le journaliste ne tarde pas à réapparaître à Paris où l’ambassadeur Abetz, une vieille connaissance, lui apprend incidemment que Degrelle n’est absolument pas mort, mais probablement interné dans un camp du sud de la France. En dépit des divergences politiques qui ont pu opposer les deux hommes, Daye estime alors de son devoir de se porter au secours du chef de Rex et part aussitôt à sa recherche. Accompagné de Jacques Crokaert et Carl Doutreligne, il file à Vichy, rencontre Adrien Marquet mais aussi plusieurs ministres belges en déréliction… L’administration française n’ayant pas mis longtemps à localiser Degrelle qui se trouve dans l’Ariège, au camp du Vernet, le trio de sauveteurs (« mes trois mousquetaires » dira Degrelle dans La cohue de 40) s’empresse de reprendre la route. Quelques heures plus tard, ils sont à Carcassonne où ils retrouvent enfin Léon Degrelle, « sale, amaigri, méconnaissable » (37), ainsi que l’ex-député rexiste Gustave Wyns.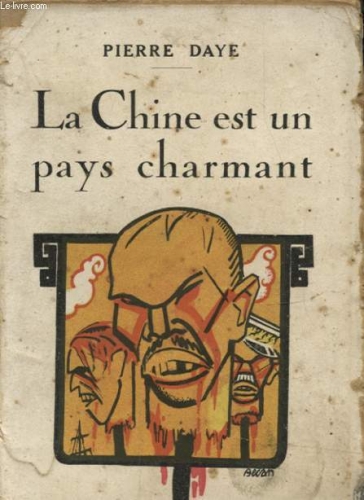 Loin d’être le pestiféré qu’il deviendra bientôt, Pierre Daye conserve en cette époque troublée de nombreuses relations mondaines : il organise, chez lui, une rencontre entre le comte Capelle et le chef de Rex, dîne avec les frères Heymans (dont l’un, Corneille, est prix Nobel) et séjourne au Zoute, chez le banquier Wauters. Invité chez le vicomte Jacques Duvignon, ancien ambassadeur à Berlin, il revoit également Mme Destrée et Robert Poulet, tandis que lors d’un enième séjour à Paris, il croise Alphonse de Chateaubriant (qui l’accueille dans les locaux de La Gerbe), Bernard Grasset, l’historien Pierre Bessand-Massenet et Stanislas de la Rochefoucauld. Si, en dépit des circonstances, Pierre Daye est quelqu’un qui demeure attaché aux petits plaisirs de la vie et aux relations sociales, il serait erroné de ne voir en lui qu’un second couteau falot et superficiel. En fait, il sert de passerelle entre beaucoup d’acteurs importants du jeu politico-diplomatique et maintient notamment d’étroits contacts avec les proches du roi. En relation avec les secrétaires du souverain, il voit aussi, très régulièrement, les anciens ministres Maurice Lippens et Henri De Man, ainsi que le général Van Overstræten, aide-de-camp de Léopold III. Pour le palais royal, Daye est donc une précieuse source de renseignements : « Je servis bien souvent d’informateur au souverain », écrit-il, « et le bloc-notes en main, le comte Capelle prenait des indications ‘pour sa Majesté’ durant la plupart de nos entretiens » (39). Il facilite par ailleurs certains contacts improbables comme cette entrevue, chez lui, le 22 mai 1943, entre Capelle et l’abbé Louis Fierens, l’aumônier (non rexiste) de la Légion Wallonie… Aucun reproche, explicite ou implicite, ne lui ayant jamais été exprimé, le journaliste s’étonnera plus tard des accusations de félonie formulées à son encontre : « Pouvais-je n’être pas convaincu », demande-t-il dans ses mémoires, « après tous mes rapports plus ou moins directs avec lui (le roi), par l’intermédiaire de son entourage, que ma conduite était approuvée ? Ou que tout au moins, elle n’était pas blamée ? » (40). Et pour être encore plus clair, il ajoute : « Si des ‘collaborationnistes’ sincères se trompaient, Léopold III aurait dû les avertir, ou les faire avertir, même au risque de déplaire aux Allemands » (41).
Loin d’être le pestiféré qu’il deviendra bientôt, Pierre Daye conserve en cette époque troublée de nombreuses relations mondaines : il organise, chez lui, une rencontre entre le comte Capelle et le chef de Rex, dîne avec les frères Heymans (dont l’un, Corneille, est prix Nobel) et séjourne au Zoute, chez le banquier Wauters. Invité chez le vicomte Jacques Duvignon, ancien ambassadeur à Berlin, il revoit également Mme Destrée et Robert Poulet, tandis que lors d’un enième séjour à Paris, il croise Alphonse de Chateaubriant (qui l’accueille dans les locaux de La Gerbe), Bernard Grasset, l’historien Pierre Bessand-Massenet et Stanislas de la Rochefoucauld. Si, en dépit des circonstances, Pierre Daye est quelqu’un qui demeure attaché aux petits plaisirs de la vie et aux relations sociales, il serait erroné de ne voir en lui qu’un second couteau falot et superficiel. En fait, il sert de passerelle entre beaucoup d’acteurs importants du jeu politico-diplomatique et maintient notamment d’étroits contacts avec les proches du roi. En relation avec les secrétaires du souverain, il voit aussi, très régulièrement, les anciens ministres Maurice Lippens et Henri De Man, ainsi que le général Van Overstræten, aide-de-camp de Léopold III. Pour le palais royal, Daye est donc une précieuse source de renseignements : « Je servis bien souvent d’informateur au souverain », écrit-il, « et le bloc-notes en main, le comte Capelle prenait des indications ‘pour sa Majesté’ durant la plupart de nos entretiens » (39). Il facilite par ailleurs certains contacts improbables comme cette entrevue, chez lui, le 22 mai 1943, entre Capelle et l’abbé Louis Fierens, l’aumônier (non rexiste) de la Légion Wallonie… Aucun reproche, explicite ou implicite, ne lui ayant jamais été exprimé, le journaliste s’étonnera plus tard des accusations de félonie formulées à son encontre : « Pouvais-je n’être pas convaincu », demande-t-il dans ses mémoires, « après tous mes rapports plus ou moins directs avec lui (le roi), par l’intermédiaire de son entourage, que ma conduite était approuvée ? Ou que tout au moins, elle n’était pas blamée ? » (40). Et pour être encore plus clair, il ajoute : « Si des ‘collaborationnistes’ sincères se trompaient, Léopold III aurait dû les avertir, ou les faire avertir, même au risque de déplaire aux Allemands » (41). Chargé de la rubrique de politique étrangère, Pierre Daye en sera l’un des principaux chroniqueurs jusqu’en avril 1943. Le Nouveau Journal n’est pas le seul organe de presse à accueillir sa prose puisque l’on trouve également sa signature dans Junges Europa, Das Neue Europa, Europäische Revue, Signal, Actu, le Petit Parisien, Je suis partout, et qu’il s’exprime de temps à autres au micro de Radio-Bruxelles. Quoique très dense, cette activité journalistique ne l’empêche pas de publier aussi quelques nouveaux livres. En 1941, il fait ainsi paraître un essai politique, Guerre et révolution, lettre d’un Belge à un ami français, suivi d’un Rubens, puis de Par le monde qui change, un ouvrage où il évoque quelques-uns des pays qu’il a visités, décerne au passage quelques compliments au Reich pour avoir encouragé la jeunesse et amélioré la race, et décrit Adolf Hitler comme « un homme simple, très différend des hobereaux allemands d’autrefois » (45). Si l’homme de lettres ne fait pas mystère de ses sympathies, il s’abstient toutefois de franchir certaines limites : il garde notamment ses distances avec la Légion Wallonie et fait même publiquement savoir qu’il n’est jamais intervenu en sa faveur auprès du palais royal. Il admire, dit-il, le courage des volontaires mais ne comprend pas vraiment leur démarche. Très attaché à l’unité et à l’intégrité de la Belgique comme à la personne du roi, il prend grand soin de ne jamais cautionner une autre ligne que celle-là. Hostile à la persécution des Juifs comme à tout démembrement du royaume, Pierre Daye considère globalement les affaires politiques d’un œil sévère : « Trop de gens aux dents longues, trop de bonshommes intéressés. Trop de tripotages. Trop de fortunes aussi gigantesques que rapides » (46). Désireux de voir la Belgique se réorganiser sur un schéma centralisateur, monarchique et corporatif, il regroupe autour de lui un « Bureau politique », auquel prennent part ses amis Gustave Wyns et Jacques Crokaert, puis s’associe, en mai 1941, à la tentative de créer un Parti des Provinces Romanes. Ce dernier doit soutenir l’Ordre Nouveau européen, protéger la race et favoriser la fondation d’un État autoritaire, corporatif et chrétien (47). Le projet fera long feu car le 5 août 1941, les autorités allemandes y opposent leur veto. Autre geste politique de Pierre Daye : le 1er février 1943, il adhère à la Société Européenne des Écrivains (48) et plus précisément à l’une de ses deux sections belges, la Communauté Culturelle Wallonne (49). Cet engagement sans détour ne fait cependant pas de lui un fanatique ou un ultra, et c’est assez souvent, il faut le dire, qu’il intervient en faveur de certains Israélites ou de résistants (dont le communiste Albert Marteaux et le socialiste Victor Larock).
Chargé de la rubrique de politique étrangère, Pierre Daye en sera l’un des principaux chroniqueurs jusqu’en avril 1943. Le Nouveau Journal n’est pas le seul organe de presse à accueillir sa prose puisque l’on trouve également sa signature dans Junges Europa, Das Neue Europa, Europäische Revue, Signal, Actu, le Petit Parisien, Je suis partout, et qu’il s’exprime de temps à autres au micro de Radio-Bruxelles. Quoique très dense, cette activité journalistique ne l’empêche pas de publier aussi quelques nouveaux livres. En 1941, il fait ainsi paraître un essai politique, Guerre et révolution, lettre d’un Belge à un ami français, suivi d’un Rubens, puis de Par le monde qui change, un ouvrage où il évoque quelques-uns des pays qu’il a visités, décerne au passage quelques compliments au Reich pour avoir encouragé la jeunesse et amélioré la race, et décrit Adolf Hitler comme « un homme simple, très différend des hobereaux allemands d’autrefois » (45). Si l’homme de lettres ne fait pas mystère de ses sympathies, il s’abstient toutefois de franchir certaines limites : il garde notamment ses distances avec la Légion Wallonie et fait même publiquement savoir qu’il n’est jamais intervenu en sa faveur auprès du palais royal. Il admire, dit-il, le courage des volontaires mais ne comprend pas vraiment leur démarche. Très attaché à l’unité et à l’intégrité de la Belgique comme à la personne du roi, il prend grand soin de ne jamais cautionner une autre ligne que celle-là. Hostile à la persécution des Juifs comme à tout démembrement du royaume, Pierre Daye considère globalement les affaires politiques d’un œil sévère : « Trop de gens aux dents longues, trop de bonshommes intéressés. Trop de tripotages. Trop de fortunes aussi gigantesques que rapides » (46). Désireux de voir la Belgique se réorganiser sur un schéma centralisateur, monarchique et corporatif, il regroupe autour de lui un « Bureau politique », auquel prennent part ses amis Gustave Wyns et Jacques Crokaert, puis s’associe, en mai 1941, à la tentative de créer un Parti des Provinces Romanes. Ce dernier doit soutenir l’Ordre Nouveau européen, protéger la race et favoriser la fondation d’un État autoritaire, corporatif et chrétien (47). Le projet fera long feu car le 5 août 1941, les autorités allemandes y opposent leur veto. Autre geste politique de Pierre Daye : le 1er février 1943, il adhère à la Société Européenne des Écrivains (48) et plus précisément à l’une de ses deux sections belges, la Communauté Culturelle Wallonne (49). Cet engagement sans détour ne fait cependant pas de lui un fanatique ou un ultra, et c’est assez souvent, il faut le dire, qu’il intervient en faveur de certains Israélites ou de résistants (dont le communiste Albert Marteaux et le socialiste Victor Larock).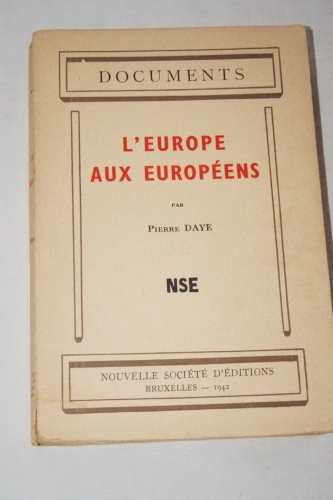 La guerre n’a pas émoussé le goût pour les voyages de Pierre Daye qui continue, dans la mesure où les événements le permettent, à se déplacer en Europe. Début 1942, il est par exemple au Portugal, puis en août en Hongrie, et séjourne, en fin d’année, à Rome. Dans la ville éternelle, il renoue avec de vieux amis, comme la duchesse de Villarosa ou le sénateur Aldobrandini Rangoni, tous très anglophiles, et s’entretient, le 10 janvier 1943, avec le prince Umberto. Quatre jours auparavant, il a pu être reçu par le Souverain Pontife, ce qui revêt pour lui une importance toute particulière. Grâce à un proche du Pape, le père jésuite Tacchi-Venturi, il a en effet obtenu de voir brièvement Sa Sainteté Pie XII qui l’a interrogé sur la situation belge et lui a donné sa bénédiction. « Ce qui m’avait le plus ému durant cette entrevue », rapporte-t-il, « c’est la grande allure du Saint-Père, son air de seigneur, la beauté de son visage ascétique et blême, avec ses yeux d’un noir brillant, sa longue bouche volontaire, son nez en bec d’aigle, la noblesse de ses gestes » (50). Peu de temps après cette promenade italienne, en février-mars 1943, Pierre Daye se rend à Madrid. N’étant inféodé à aucune faction politique, il profite de ce passage dans un pays non-belligérant pour adresser, de son propre chef, un courrier à Paul van Zeeland : « Il faut souhaiter », lui écrit-il, « que des éléments provenant des deux clans entre lesquels se divise aujourd’hui la Belgique, celui des “gens de Londres“ et celui de ceux que vous appelez, je crois, les “collaborationnistes“ (je suis pour ma part convaincu que tous deux comptent des patriotes sincères) puissent bientôt, à l’issue des hostilités, se comprendre et collaborer, autour du Roi, dans l’intérêt même de notre pays » (51). Par le biais de l’armateur Pierre Grisar, il envoie une missive du même genre à Hubert Pierlot, le chef du gouvernement belge en exil. Faut-il préciser qu’il n’obtiendra aucune réponse…
La guerre n’a pas émoussé le goût pour les voyages de Pierre Daye qui continue, dans la mesure où les événements le permettent, à se déplacer en Europe. Début 1942, il est par exemple au Portugal, puis en août en Hongrie, et séjourne, en fin d’année, à Rome. Dans la ville éternelle, il renoue avec de vieux amis, comme la duchesse de Villarosa ou le sénateur Aldobrandini Rangoni, tous très anglophiles, et s’entretient, le 10 janvier 1943, avec le prince Umberto. Quatre jours auparavant, il a pu être reçu par le Souverain Pontife, ce qui revêt pour lui une importance toute particulière. Grâce à un proche du Pape, le père jésuite Tacchi-Venturi, il a en effet obtenu de voir brièvement Sa Sainteté Pie XII qui l’a interrogé sur la situation belge et lui a donné sa bénédiction. « Ce qui m’avait le plus ému durant cette entrevue », rapporte-t-il, « c’est la grande allure du Saint-Père, son air de seigneur, la beauté de son visage ascétique et blême, avec ses yeux d’un noir brillant, sa longue bouche volontaire, son nez en bec d’aigle, la noblesse de ses gestes » (50). Peu de temps après cette promenade italienne, en février-mars 1943, Pierre Daye se rend à Madrid. N’étant inféodé à aucune faction politique, il profite de ce passage dans un pays non-belligérant pour adresser, de son propre chef, un courrier à Paul van Zeeland : « Il faut souhaiter », lui écrit-il, « que des éléments provenant des deux clans entre lesquels se divise aujourd’hui la Belgique, celui des “gens de Londres“ et celui de ceux que vous appelez, je crois, les “collaborationnistes“ (je suis pour ma part convaincu que tous deux comptent des patriotes sincères) puissent bientôt, à l’issue des hostilités, se comprendre et collaborer, autour du Roi, dans l’intérêt même de notre pays » (51). Par le biais de l’armateur Pierre Grisar, il envoie une missive du même genre à Hubert Pierlot, le chef du gouvernement belge en exil. Faut-il préciser qu’il n’obtiendra aucune réponse…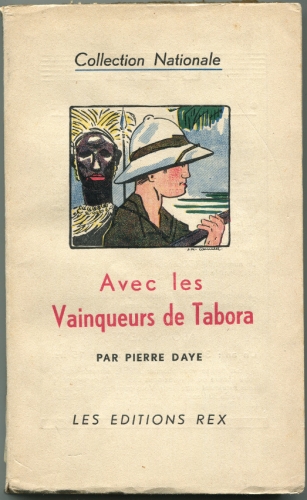 Présent dans les gazettes, Pierre Daye l’est tout autant aux devantures des librairies : en 1942, il fait paraître deux essais politiques (L ‘Europe aux Européens et Trente-deux mois chez les députés), puis en 1943, un texte sur l’Afrique (Problèmes congolais), et en 1944, un recueil de contes (D’ombre et de lumière). À compter de 1943, son engagement se concrétise aussi par son accession à un poste officiel dans l’administration belge. Sur recommandation du Flamand Gérard Romsée, il est en effet nommé, le 25 juin 1943, au poste un peu inattendu de … commissaire général à l’Éducation Physique et aux Sports. En soi, il s’agit d’une fonction peu compromettante et qui fournit à son titulaire d’excellentes justifications pour voyager. Reste qu’elle fait de Pierre Daye un fonctionnaire officiel de la collaboration, ce qui peut se révéler extrêmement dangereux. De fait, loin d’aller vers l’apaisement qu’il souhaitait, la situation se dégrade et les rivalités belges se muent désormais en sanglants règlements de compte. « Les hitlériens de nationalité belge [sont] plus abjects encore que leurs maîtres allemands », proclame un journal clandestin communiste. « Cette vermine immonde doit être écrasée (…) Les Partisans belges se sont juré de liquider ces bêtes puantes » (53) L’année 1942 est ponctuée d’au moins 67 attentats et l’année 1943 connaît une recrudescence vertigineuse des actes violents, au point que le chef de l’administration allemande, Eggert Reeder, parle carrément d’une vague de meurtres ou Mordwelle. « Dans la rue et les campagnes, surtout à partir de 1943 », écrit une historienne belge, « règne une atmosphère de guerre civile : rexistes et nationalistes flamands, ainsi que les membres de leurs familles, sont abattus, sans autre forme de procès, sans distinction d’âge ou de sexe » (54).
Présent dans les gazettes, Pierre Daye l’est tout autant aux devantures des librairies : en 1942, il fait paraître deux essais politiques (L ‘Europe aux Européens et Trente-deux mois chez les députés), puis en 1943, un texte sur l’Afrique (Problèmes congolais), et en 1944, un recueil de contes (D’ombre et de lumière). À compter de 1943, son engagement se concrétise aussi par son accession à un poste officiel dans l’administration belge. Sur recommandation du Flamand Gérard Romsée, il est en effet nommé, le 25 juin 1943, au poste un peu inattendu de … commissaire général à l’Éducation Physique et aux Sports. En soi, il s’agit d’une fonction peu compromettante et qui fournit à son titulaire d’excellentes justifications pour voyager. Reste qu’elle fait de Pierre Daye un fonctionnaire officiel de la collaboration, ce qui peut se révéler extrêmement dangereux. De fait, loin d’aller vers l’apaisement qu’il souhaitait, la situation se dégrade et les rivalités belges se muent désormais en sanglants règlements de compte. « Les hitlériens de nationalité belge [sont] plus abjects encore que leurs maîtres allemands », proclame un journal clandestin communiste. « Cette vermine immonde doit être écrasée (…) Les Partisans belges se sont juré de liquider ces bêtes puantes » (53) L’année 1942 est ponctuée d’au moins 67 attentats et l’année 1943 connaît une recrudescence vertigineuse des actes violents, au point que le chef de l’administration allemande, Eggert Reeder, parle carrément d’une vague de meurtres ou Mordwelle. « Dans la rue et les campagnes, surtout à partir de 1943 », écrit une historienne belge, « règne une atmosphère de guerre civile : rexistes et nationalistes flamands, ainsi que les membres de leurs familles, sont abattus, sans autre forme de procès, sans distinction d’âge ou de sexe » (54).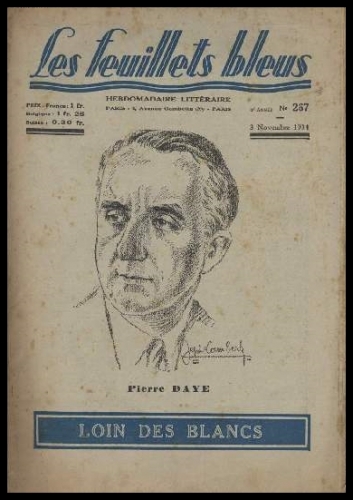 Profondément choqué par le déferlement de violence auquel il assiste, Pierre Daye en juge sévèrement les inspirateurs : « Il fallait », constate-t-il amèrement, « par la provocation, empoisonner une atmosphère trop paisible, donc trop favorable à l’occupant. Il fallait susciter des vengeances, allumer l’esprit de représailles » (58). Et confronté à cet engrenage fatal (59), il en décrit tristement le mécanisme : « De braves gens, mûs uniquement par le sentiment patriotique, ne se doutaient point du vrai rôle qu’on leur faisait ainsi jouer. Et des canailles trouvaient, en se glissant parmi eux, le moyen de commettre les plus bas crimes (…) Se sentant sans protection, d’autres braves gens, de l’autre idéologie, se dirent alors qu’il fallait se défendre soi-même ; non pas se venger, mais si l’on voulait vivre, répondre à la terreur par la terreur » (60).
Profondément choqué par le déferlement de violence auquel il assiste, Pierre Daye en juge sévèrement les inspirateurs : « Il fallait », constate-t-il amèrement, « par la provocation, empoisonner une atmosphère trop paisible, donc trop favorable à l’occupant. Il fallait susciter des vengeances, allumer l’esprit de représailles » (58). Et confronté à cet engrenage fatal (59), il en décrit tristement le mécanisme : « De braves gens, mûs uniquement par le sentiment patriotique, ne se doutaient point du vrai rôle qu’on leur faisait ainsi jouer. Et des canailles trouvaient, en se glissant parmi eux, le moyen de commettre les plus bas crimes (…) Se sentant sans protection, d’autres braves gens, de l’autre idéologie, se dirent alors qu’il fallait se défendre soi-même ; non pas se venger, mais si l’on voulait vivre, répondre à la terreur par la terreur » (60).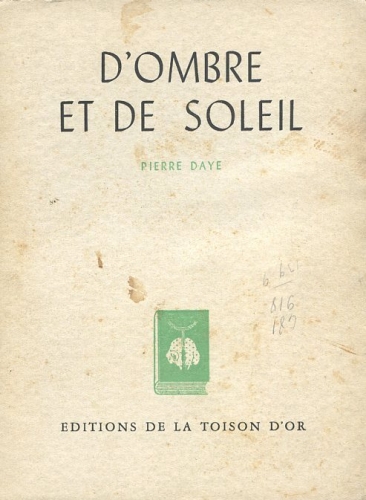 Les premiers temps d’exil ne sont pas trop durs car l’expatrié possède encore quelques relations : il est reçu chez le phalangiste Eugenio d’Ors (66) ou chez le général Eugenio Espinosa de los Monteros, ancien ambassadeur à Berlin, et dîne même parfois avec Walter Starkie (67), le directeur de l’Institut Britannique de Madrid. Plus tard, il verra de temps en temps François Piétri et l’académicien Abel Bonnard. Quelles que soient les difficultés qu’il rencontre et la peine qu’il éprouve, cet exil lui épargne à tout le moins un sort funeste. L’épuration belge se veut en effet particulièrement vindicative puisque, si l’on en croit Paul Sérant, un certain Marcel Houtman exige par exemple que soient exécutés tous les Belges ayant combattu sur le front de l’Est, tous les écrivains et journalistes de la collaboration et tous les fonctionnaires ayant servi les desseins de l’occupant ! (68) Les intellectuels ne peuvent donc guère espérer de mansuétude. Le poète René Baert a été sommairement abattu au coin d’un bois, quelque part en Allemagne, plusieurs journalistes sont condamnés à la peine capitale et fusillés (Paul Herten, José Sreel, Jules Lhoste, Victor Meulenyser, Charles Nisolles, Paul Lespagnard), d’autres échappent de très peu au poteau (Robert Poulet, Paul Jamin), et quelques-uns, comme Pierre Hubermont et Gabriel Figeys, écopent de lourdes peines de détention. Le peintre Marc Eemans est frappé d’une peine de huit ans de prison, tandis que le dramaturge Michel de Ghelderode se fait copieusement insulter et chasser de son emploi. Beaucoup ne retrouveront un peu de tranquillité qu’à l’étranger : Simenon, Hergé et Henri de Man en Suisse, Paul Werrie en Espagne puis en France, Raymond de Becker (condamné à mort puis à la détention perpétuelle), Claude Elsen (condamné à mort par contumace) et Louis Carette (condamné par contumace à 15 ans de travaux forcés) en France. Certains feront malgré tout, hors de Belgique, de brillantes carrières : émigré à Paris, Oscar Van Godtsenhoven, alias Jan Van Dorp, y remportera un prix (1948) pour son Flamand des vagues ; Louis Carette, alias Félicien Marceau, sera élu à l’Académie française (1975), tandis que Jean Libert et Gaston Vandenpanhuyse vendront des milliers de livres sous les noms d’emprunt de Paul Kenny et Jean-Gaston Vandel. « La répression contre les intellectuels », note Elsa Van Brusseghem-Loorne, « surtout en Wallonie (69), prendra (…) une tournure dramatique et particulièrement cruelle, comme si le pouvoir, détenu par des classes en déclin, voulait éliminer par tous les moyens ceux qui, par leurs efforts, étaient la preuve vivante de son infériorité culturelle » (70)…
Les premiers temps d’exil ne sont pas trop durs car l’expatrié possède encore quelques relations : il est reçu chez le phalangiste Eugenio d’Ors (66) ou chez le général Eugenio Espinosa de los Monteros, ancien ambassadeur à Berlin, et dîne même parfois avec Walter Starkie (67), le directeur de l’Institut Britannique de Madrid. Plus tard, il verra de temps en temps François Piétri et l’académicien Abel Bonnard. Quelles que soient les difficultés qu’il rencontre et la peine qu’il éprouve, cet exil lui épargne à tout le moins un sort funeste. L’épuration belge se veut en effet particulièrement vindicative puisque, si l’on en croit Paul Sérant, un certain Marcel Houtman exige par exemple que soient exécutés tous les Belges ayant combattu sur le front de l’Est, tous les écrivains et journalistes de la collaboration et tous les fonctionnaires ayant servi les desseins de l’occupant ! (68) Les intellectuels ne peuvent donc guère espérer de mansuétude. Le poète René Baert a été sommairement abattu au coin d’un bois, quelque part en Allemagne, plusieurs journalistes sont condamnés à la peine capitale et fusillés (Paul Herten, José Sreel, Jules Lhoste, Victor Meulenyser, Charles Nisolles, Paul Lespagnard), d’autres échappent de très peu au poteau (Robert Poulet, Paul Jamin), et quelques-uns, comme Pierre Hubermont et Gabriel Figeys, écopent de lourdes peines de détention. Le peintre Marc Eemans est frappé d’une peine de huit ans de prison, tandis que le dramaturge Michel de Ghelderode se fait copieusement insulter et chasser de son emploi. Beaucoup ne retrouveront un peu de tranquillité qu’à l’étranger : Simenon, Hergé et Henri de Man en Suisse, Paul Werrie en Espagne puis en France, Raymond de Becker (condamné à mort puis à la détention perpétuelle), Claude Elsen (condamné à mort par contumace) et Louis Carette (condamné par contumace à 15 ans de travaux forcés) en France. Certains feront malgré tout, hors de Belgique, de brillantes carrières : émigré à Paris, Oscar Van Godtsenhoven, alias Jan Van Dorp, y remportera un prix (1948) pour son Flamand des vagues ; Louis Carette, alias Félicien Marceau, sera élu à l’Académie française (1975), tandis que Jean Libert et Gaston Vandenpanhuyse vendront des milliers de livres sous les noms d’emprunt de Paul Kenny et Jean-Gaston Vandel. « La répression contre les intellectuels », note Elsa Van Brusseghem-Loorne, « surtout en Wallonie (69), prendra (…) une tournure dramatique et particulièrement cruelle, comme si le pouvoir, détenu par des classes en déclin, voulait éliminer par tous les moyens ceux qui, par leurs efforts, étaient la preuve vivante de son infériorité culturelle » (70)…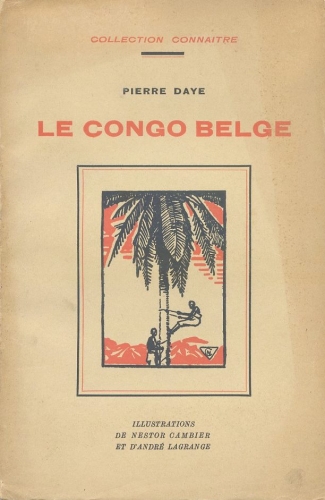 Âgé de 55 ans et plutôt combatif, l’homme est cependant loin d’avoir dit son dernier mot. Le 29 juin 1948, il prend part, avec quelques autres expatriés (75), à la création de la Société Argentine pour l’Accueil des Européens ou Sociedad Argentina para la Recepción de Europeos (SARE). Jouissant de la discrète protection de l’anthropologue Santiago Peralta, patron des services d’immigration, et bénéficiant des encouragements du cardinal Santiago Luis Copello (1880-1967), cette société s’efforce d’aider les « maudits » qui continuent d’affluer sur les rives du Rio de la Plata. Pierre Daye reprend aussi son métier de journaliste et participe au lancement de plusieurs publications dont Hebdo (1947), Europe-Argentine (1948), Argentina 49, Paroles françaises et Nouvelles d’Argentine. Naturalisé argentin en 1949, il collabore également aux revues Criterio et Itinerarium, à El Economista, le journal que fonde l’ancien Premier ministre yougoslave Milan Stojadinović (1888-1961), ainsi qu’à Dinámica Social, le mensuel que lance, en 1952, l’ancien hiérarque fasciste Carló Scorza (alias Camillo Sirtori)-(76). Organe officiel du Centre d’Études Économiques et Sociales, cette revue regroupe de nombreuses plumes de talent dont celles du philosophe roumain Georges Uscatescu, d’Ante Pavelić (alias A. S. Mrzlodolski), du père Juan Ramon Sepich, de Julio Irazusta, ou encore de Jean Pleyber, André Thérive, Jacques de Mahieu et Jacques Ploncard (alias Jacques de Sainte-Marie). Pierre Daye ne délaisse pas non plus le terrain politique où il parvient, avec son entregent habituel, à rester en bons termes à la fois avec les traditionalistes catholiques et les péronistes. Durant l’été 1949, il a quelques contacts avec le Centre des Forces Nationalistes, mais s’intéresse aussi à la Troisième Position de Juan Perón. Avec Radu Ghenea, Georges Guilbaud, René Lagrou (77) et Victor de la Serna, il signe d’ailleurs à ce sujet une note qui sera remise au chef de l’État. En septembre 1950, l’écrivain a le plaisir de renouer avec le ministre belge Marcel Henri Jaspar (1901-1982) qui est de passage dans le cône sud. Autre contact important, Sir Oswald Mosley, qu’il rencontre en novembre 1950, lors de la visite que l’ancien chef de la British Union of Fascists fait en Argentine (78). Venu s’entretenir avec Hans Ulrich Rudel, l’Anglais sera reçu par Juan Perón. Installé à Buenos Aires, dans le quartier de Palermo, et nommé professeur à l’Université de La Plata (sur recommandation de son ami le ministre des Affaires Étrangères Hipólito Jesús Paz), Pierre Daye entretient d’autre part une abondante correspondance.
Âgé de 55 ans et plutôt combatif, l’homme est cependant loin d’avoir dit son dernier mot. Le 29 juin 1948, il prend part, avec quelques autres expatriés (75), à la création de la Société Argentine pour l’Accueil des Européens ou Sociedad Argentina para la Recepción de Europeos (SARE). Jouissant de la discrète protection de l’anthropologue Santiago Peralta, patron des services d’immigration, et bénéficiant des encouragements du cardinal Santiago Luis Copello (1880-1967), cette société s’efforce d’aider les « maudits » qui continuent d’affluer sur les rives du Rio de la Plata. Pierre Daye reprend aussi son métier de journaliste et participe au lancement de plusieurs publications dont Hebdo (1947), Europe-Argentine (1948), Argentina 49, Paroles françaises et Nouvelles d’Argentine. Naturalisé argentin en 1949, il collabore également aux revues Criterio et Itinerarium, à El Economista, le journal que fonde l’ancien Premier ministre yougoslave Milan Stojadinović (1888-1961), ainsi qu’à Dinámica Social, le mensuel que lance, en 1952, l’ancien hiérarque fasciste Carló Scorza (alias Camillo Sirtori)-(76). Organe officiel du Centre d’Études Économiques et Sociales, cette revue regroupe de nombreuses plumes de talent dont celles du philosophe roumain Georges Uscatescu, d’Ante Pavelić (alias A. S. Mrzlodolski), du père Juan Ramon Sepich, de Julio Irazusta, ou encore de Jean Pleyber, André Thérive, Jacques de Mahieu et Jacques Ploncard (alias Jacques de Sainte-Marie). Pierre Daye ne délaisse pas non plus le terrain politique où il parvient, avec son entregent habituel, à rester en bons termes à la fois avec les traditionalistes catholiques et les péronistes. Durant l’été 1949, il a quelques contacts avec le Centre des Forces Nationalistes, mais s’intéresse aussi à la Troisième Position de Juan Perón. Avec Radu Ghenea, Georges Guilbaud, René Lagrou (77) et Victor de la Serna, il signe d’ailleurs à ce sujet une note qui sera remise au chef de l’État. En septembre 1950, l’écrivain a le plaisir de renouer avec le ministre belge Marcel Henri Jaspar (1901-1982) qui est de passage dans le cône sud. Autre contact important, Sir Oswald Mosley, qu’il rencontre en novembre 1950, lors de la visite que l’ancien chef de la British Union of Fascists fait en Argentine (78). Venu s’entretenir avec Hans Ulrich Rudel, l’Anglais sera reçu par Juan Perón. Installé à Buenos Aires, dans le quartier de Palermo, et nommé professeur à l’Université de La Plata (sur recommandation de son ami le ministre des Affaires Étrangères Hipólito Jesús Paz), Pierre Daye entretient d’autre part une abondante correspondance. 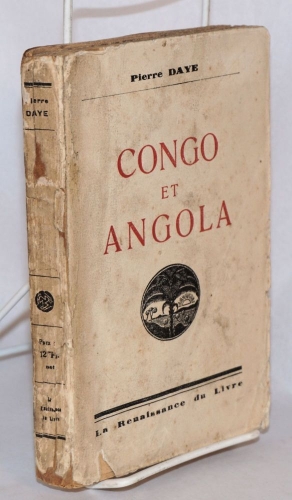 La chute de Juan Perón, en septembre 1955, n’entraîne pas d’inconvénients majeurs pour Pierre Daye qui n’est pas vraiment un acteur de la vie politique locale. Tenu pour proche du péronisme, il se retrouve néanmoins marginalisé et éloigné des nouveaux cercles dirigeants. Plus que le changement de régime, c’est plutôt l’isolement et l’oubli qui le menacent désormais. Le temps fait lentement son œuvre et la plupart des Belges l’ont d’ores et déjà oublié. Pas mal d’émigrés ont regagné l’Europe, on lui demande de moins en moins d’articles et la solitude le guette. C’est dans ce contexte un peu maussade que le 20 février 1960, à un peu moins de 68 ans, une hémorragie cérébrale vient brutalement mettre un terme à son existence. Cultivé, discret et fort modéré, on se demande encore ce que cet homme avait bien pu faire pour que la Belgique d’après-guerre lui témoigne d’une vindicte aussi tenace. Se pourrait-il tout simplement que l’on ait jugé, en haut lieu, qu’il en savait beaucoup trop long sur les arcanes (et les drôles de combines) de l’Occupation et qu’il fallait le discréditer à jamais ?
La chute de Juan Perón, en septembre 1955, n’entraîne pas d’inconvénients majeurs pour Pierre Daye qui n’est pas vraiment un acteur de la vie politique locale. Tenu pour proche du péronisme, il se retrouve néanmoins marginalisé et éloigné des nouveaux cercles dirigeants. Plus que le changement de régime, c’est plutôt l’isolement et l’oubli qui le menacent désormais. Le temps fait lentement son œuvre et la plupart des Belges l’ont d’ores et déjà oublié. Pas mal d’émigrés ont regagné l’Europe, on lui demande de moins en moins d’articles et la solitude le guette. C’est dans ce contexte un peu maussade que le 20 février 1960, à un peu moins de 68 ans, une hémorragie cérébrale vient brutalement mettre un terme à son existence. Cultivé, discret et fort modéré, on se demande encore ce que cet homme avait bien pu faire pour que la Belgique d’après-guerre lui témoigne d’une vindicte aussi tenace. Se pourrait-il tout simplement que l’on ait jugé, en haut lieu, qu’il en savait beaucoup trop long sur les arcanes (et les drôles de combines) de l’Occupation et qu’il fallait le discréditer à jamais ?






 Cependant, qu'on l'appelle sécession ou retrait de la vie publique, la "sécession" est toujours un moment de contestation du pouvoir, à partir de la république romaine et du retrait de l'Aventin (de 494 a.J.C.).
Cependant, qu'on l'appelle sécession ou retrait de la vie publique, la "sécession" est toujours un moment de contestation du pouvoir, à partir de la république romaine et du retrait de l'Aventin (de 494 a.J.C.). La menace à l'ordre social a été perçue autrefois, comme une des réponses à la "Révolte des masses"(Ortega y Gasset-1930). Cette menace, venant de la social- démocratie, du marxisme théorique et de la révolution russe, fut à la racine d'une réflexion, sur la théorie des élites, représentée, autour des années 1920, par Pareto, Mosca et Michels, en réponse au dysfonctionnement du régime libéral et de son système parlementaire.
La menace à l'ordre social a été perçue autrefois, comme une des réponses à la "Révolte des masses"(Ortega y Gasset-1930). Cette menace, venant de la social- démocratie, du marxisme théorique et de la révolution russe, fut à la racine d'une réflexion, sur la théorie des élites, représentée, autour des années 1920, par Pareto, Mosca et Michels, en réponse au dysfonctionnement du régime libéral et de son système parlementaire. 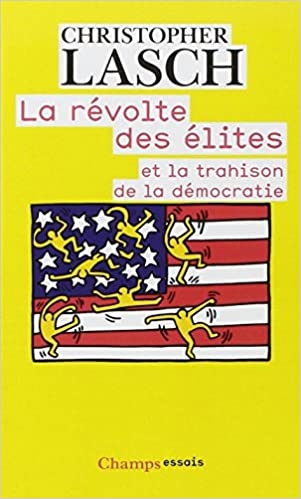 "La révolte des Élites" de C.Lasch(1993), marque désormais l'avènement de l'individualisme narcissique et met à nu les illusions de la démocratie.
"La révolte des Élites" de C.Lasch(1993), marque désormais l'avènement de l'individualisme narcissique et met à nu les illusions de la démocratie.

 Douwe Kalma opposait l’idée d’une Grande Frise à celle d’une Grande Néerlande, en exprimant de la sorte les liens, qu’il ressentait comme réels et charnels, entre les Frisons des Pays-Bas et ceux de Frise septentrionale et de Frise orientale qui vivaient sous les administrations allemande et danoise. Simultanément, il plaidait pour une Grande Frise qui aurait eu pour fonction de faire pont entre la Scandinavie et l’Angleterre, afin de lier des peuples qui, selon lui, étaient très proches depuis longtemps et qui présentaient certaines affinités mentales. Pour pouvoir donner forme à cette fonction de pont, la Frise, selon Kalma, devait réclamer une plus grande autonomie ; il fallait, pour cela, que ses compatriotes soient culturellement structurés.
Douwe Kalma opposait l’idée d’une Grande Frise à celle d’une Grande Néerlande, en exprimant de la sorte les liens, qu’il ressentait comme réels et charnels, entre les Frisons des Pays-Bas et ceux de Frise septentrionale et de Frise orientale qui vivaient sous les administrations allemande et danoise. Simultanément, il plaidait pour une Grande Frise qui aurait eu pour fonction de faire pont entre la Scandinavie et l’Angleterre, afin de lier des peuples qui, selon lui, étaient très proches depuis longtemps et qui présentaient certaines affinités mentales. Pour pouvoir donner forme à cette fonction de pont, la Frise, selon Kalma, devait réclamer une plus grande autonomie ; il fallait, pour cela, que ses compatriotes soient culturellement structurés.
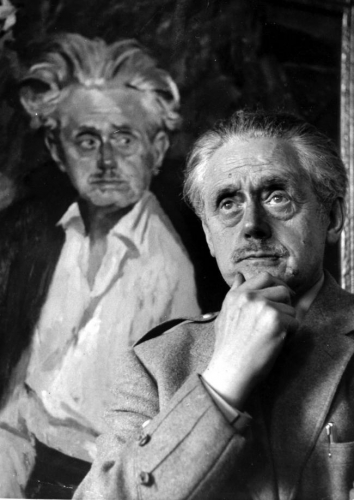
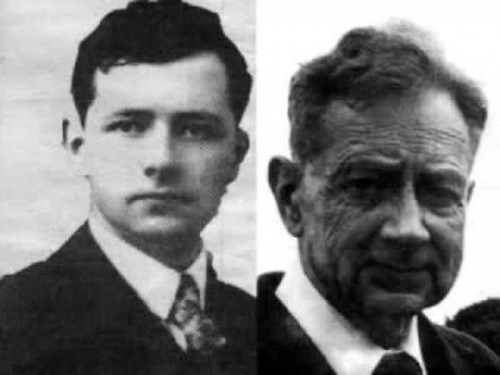
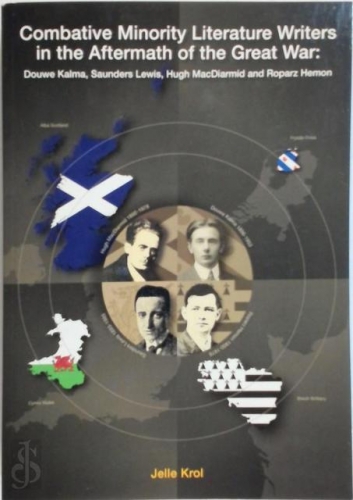



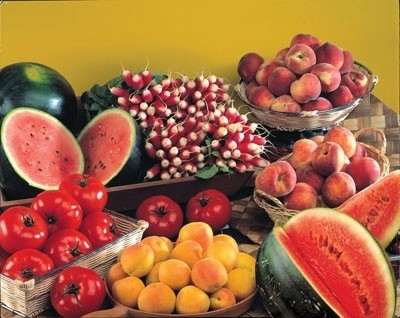

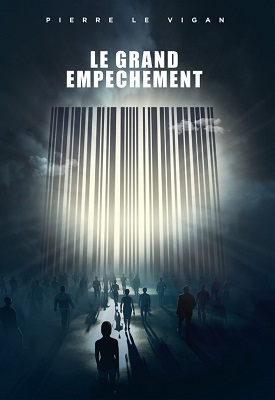 C’est un projet de contrôle total, et de contrôle mondial des peuples. Dans cette perspective, les idées de revenu universel peuvent être un élément : il s’agit de rendre tout le monde dépendant de l’Etat, via les banques, bien sûr, et c’est déjà le cas, et via les versements sociaux. Il s’agit aussi d’institutionnaliser le fait qu’une partie de la population est « inutile », « inemployable », et que l’on renonce à toute perspective de travail pour tous. De ce fait, un certain emploi du revenu universel, loin de desserrer la contrainte marchande – ce qui est l’espoir de beaucoup de ses promoteurs – risque d’aboutir à l’effet inverse. Il est conçu par les mondialistes libéraux comme une contrepartie de la destruction des services publics et des biens communs. Il faut, plutôt qu’un revenu universel, restaurer et amplifier les communs. Mieux vaut des soins « gratuits » c’est-à-dire pris en charge par la collectivité, que des soins payants, et un revenu universel pour aider chacun à accéder à ces services payants, et à se soigner plus ou moins. Et surtout, le revenu universel ne donne pas la dignité que donne un travail, car il n’y a pas de travail idiot. Pas sûr, donc, que le turbo-capitalisme et l’économie de casino ne repartent de plus belle. Je suis, pour ma part, résolument favorable à la planification économique, à l’économie dirigée, à l’économie autocentrée. Cela ne peut se faire par le libre jeu du marché.
C’est un projet de contrôle total, et de contrôle mondial des peuples. Dans cette perspective, les idées de revenu universel peuvent être un élément : il s’agit de rendre tout le monde dépendant de l’Etat, via les banques, bien sûr, et c’est déjà le cas, et via les versements sociaux. Il s’agit aussi d’institutionnaliser le fait qu’une partie de la population est « inutile », « inemployable », et que l’on renonce à toute perspective de travail pour tous. De ce fait, un certain emploi du revenu universel, loin de desserrer la contrainte marchande – ce qui est l’espoir de beaucoup de ses promoteurs – risque d’aboutir à l’effet inverse. Il est conçu par les mondialistes libéraux comme une contrepartie de la destruction des services publics et des biens communs. Il faut, plutôt qu’un revenu universel, restaurer et amplifier les communs. Mieux vaut des soins « gratuits » c’est-à-dire pris en charge par la collectivité, que des soins payants, et un revenu universel pour aider chacun à accéder à ces services payants, et à se soigner plus ou moins. Et surtout, le revenu universel ne donne pas la dignité que donne un travail, car il n’y a pas de travail idiot. Pas sûr, donc, que le turbo-capitalisme et l’économie de casino ne repartent de plus belle. Je suis, pour ma part, résolument favorable à la planification économique, à l’économie dirigée, à l’économie autocentrée. Cela ne peut se faire par le libre jeu du marché.
 Une guerre est un affrontement entre deux puissances ; un « choc des volontés » selon Von Clausewitz qui prétendait également que « la guerre est le prolongement de la politique par d’autres moyens ». C’est invariablement un rapport de forces, associant tout à la fois brutalité par le fracas des armes et le metis ou la ruse de l’intelligence.
Une guerre est un affrontement entre deux puissances ; un « choc des volontés » selon Von Clausewitz qui prétendait également que « la guerre est le prolongement de la politique par d’autres moyens ». C’est invariablement un rapport de forces, associant tout à la fois brutalité par le fracas des armes et le metis ou la ruse de l’intelligence.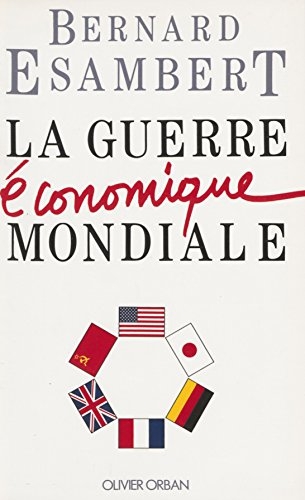 En matière de définition, selon Bernard Esambert :
En matière de définition, selon Bernard Esambert :

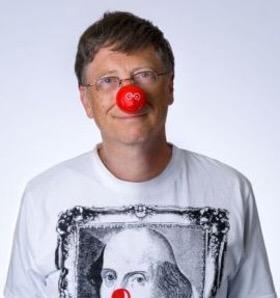 En d’autres termes, il semble que la mort prenne le dessus dans cette «guerre».
En d’autres termes, il semble que la mort prenne le dessus dans cette «guerre». 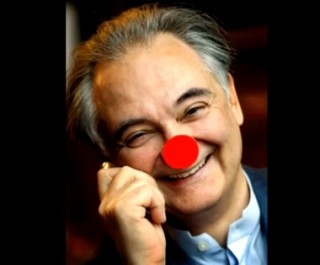 Alors, où cela nous mène-t-il ? À une schizophrénie, pas inattendue. D’une part, il y a ceux qui sont tellement sous l’emprise – au sens de J B Yeats – du statu quo, que tout autre chose qu’un rétablissement rapide de la «normalité» est hors de leur portée. La riposte mentale est fermée hermétiquement. À titre d’exemple :
Alors, où cela nous mène-t-il ? À une schizophrénie, pas inattendue. D’une part, il y a ceux qui sont tellement sous l’emprise – au sens de J B Yeats – du statu quo, que tout autre chose qu’un rétablissement rapide de la «normalité» est hors de leur portée. La riposte mentale est fermée hermétiquement. À titre d’exemple : 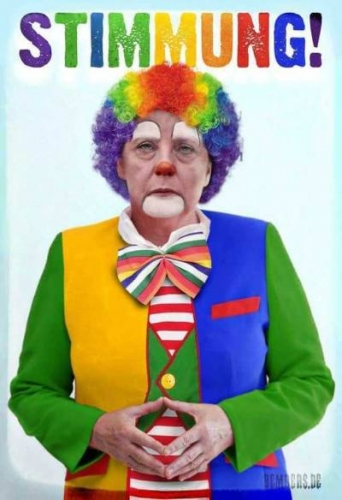 Ce qui suit sera un monde plus hésitant et prudent. Choqué économiquement, et profondément, je pense que nous serons beaucoup plus prudents à l’avenir : les utilisations de cartes de crédit seront divisées par deux ; nous essaierons d’économiser davantage et nous nous adapterons «à la décroissance». Allons-nous sortir et dépenser généreusement ? Un «sursaut» du refoulé ? Non. L’expérience pour tous a été un châtiment. Qui voit maintenant l’avenir avec certitude ? Chaque aspect de la vie va être changé. Certaines des petites entreprises réouvriront, mais beaucoup resteront fermées. Beaucoup d’entre nous continueront de travailler à domicile. Beaucoup d’entre nous ne travailleront pas du tout – et ne travailleront peut-être plus jamais.
Ce qui suit sera un monde plus hésitant et prudent. Choqué économiquement, et profondément, je pense que nous serons beaucoup plus prudents à l’avenir : les utilisations de cartes de crédit seront divisées par deux ; nous essaierons d’économiser davantage et nous nous adapterons «à la décroissance». Allons-nous sortir et dépenser généreusement ? Un «sursaut» du refoulé ? Non. L’expérience pour tous a été un châtiment. Qui voit maintenant l’avenir avec certitude ? Chaque aspect de la vie va être changé. Certaines des petites entreprises réouvriront, mais beaucoup resteront fermées. Beaucoup d’entre nous continueront de travailler à domicile. Beaucoup d’entre nous ne travailleront pas du tout – et ne travailleront peut-être plus jamais. 



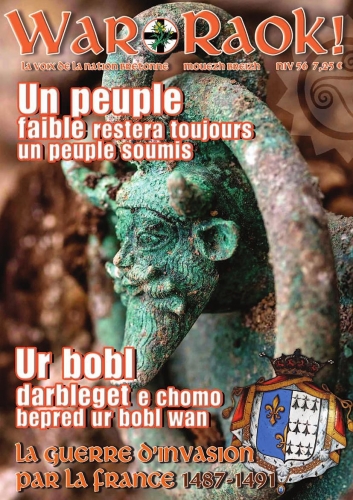




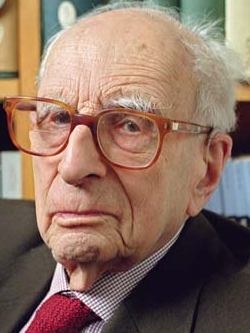 Qu’en aurait dit le grand ethnologue défenseur passionné de la diversité des sociétés humaines, Claude Lévi Strauss ? Lui qui, âgé alors de plus de cent ans, confiait qu’il allait quitter sans regret un monde où plus rien ne demeurait de ce qu’il avait aimé ? Que dirait-il devant la prolifération de ces masques qui font de chacun, de chacune, un fantôme aseptisé ? Et que dirait Emmanuel Levinas, lui qui a fondé sa philosophie de l’altérité sur le contact direct avec le regard et le visage de l’autre, dans des villes où le masque cache à chacun le visage de l’autre ?
Qu’en aurait dit le grand ethnologue défenseur passionné de la diversité des sociétés humaines, Claude Lévi Strauss ? Lui qui, âgé alors de plus de cent ans, confiait qu’il allait quitter sans regret un monde où plus rien ne demeurait de ce qu’il avait aimé ? Que dirait-il devant la prolifération de ces masques qui font de chacun, de chacune, un fantôme aseptisé ? Et que dirait Emmanuel Levinas, lui qui a fondé sa philosophie de l’altérité sur le contact direct avec le regard et le visage de l’autre, dans des villes où le masque cache à chacun le visage de l’autre ?

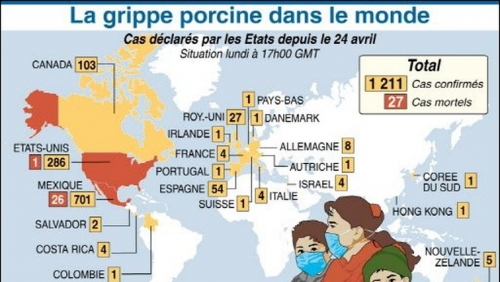
 Das niederländische Parlament deckte zudem auf, dass sich Professor Albert Osterhaus von der Erasmus-Universität in Rotterdam in einer Position befand, persönlich von den Milliarden Euro zu profitieren, die in die vermeintlich für H1N1 gedachten Impfstoffe gepumpt wurden. Als zentraler Influenza-Berater der WHO stand Osterhaus im Mittelpunkt der weltweiten Aktivitäten rund um die globale Schweinegrippe/ Influenza-A-H1N1-Pandemie von 2009. Viele andere wissenschaftliche Experten der WHO, die Chan zum Verkünden einer Pandemie rieten, erhielten direkt oder indirekt Geld von Big-Pharma-Konzernen wie Glaxo- SmithKline, Novartis und anderen führenden Impfstoffherstellern. Dass die WHO eine Schweinegrippe-Pandemie verkündete, war eine Luftnummer.
Das niederländische Parlament deckte zudem auf, dass sich Professor Albert Osterhaus von der Erasmus-Universität in Rotterdam in einer Position befand, persönlich von den Milliarden Euro zu profitieren, die in die vermeintlich für H1N1 gedachten Impfstoffe gepumpt wurden. Als zentraler Influenza-Berater der WHO stand Osterhaus im Mittelpunkt der weltweiten Aktivitäten rund um die globale Schweinegrippe/ Influenza-A-H1N1-Pandemie von 2009. Viele andere wissenschaftliche Experten der WHO, die Chan zum Verkünden einer Pandemie rieten, erhielten direkt oder indirekt Geld von Big-Pharma-Konzernen wie Glaxo- SmithKline, Novartis und anderen führenden Impfstoffherstellern. Dass die WHO eine Schweinegrippe-Pandemie verkündete, war eine Luftnummer.
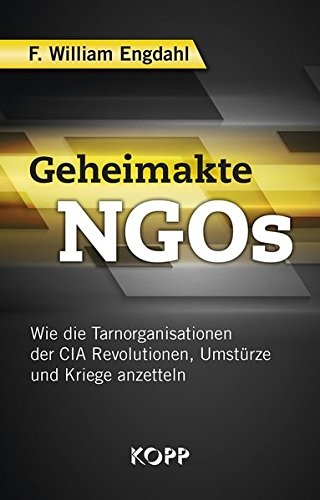 Unter den nichtstaatlichen Geldgebern finden wir die weltgrößten Impfstoff- und Medikamentenhersteller, wie Gilead Sciences (eine Firma, die derzeit darauf drängt, dass eines ihrer Produkte für die Behandlung von Covid-19 zugelassen wird), GlaxoSmithKline, Hoffmann-La Roche, Sanofi Pasteur, Merck Sharp & Dohme, Chibret und Bayer. Die Pharmaunternehmen haben die WHO 2017 mit Dutzenden Millionen Dollar unterstützt. Dass private Impfbefürworter wie die Gates Foundation und Big Pharma die WHO so stark unterstützen, ist mehr als nur ein reiner Interessenkonflikt; es bedeutet im Grunde, dass sie die Ausrichtung der Organisation in ihrem Sinne beeinflusst haben, denn eigentlich ist die WHO dafür zuständig, die weltweiten Reaktionen auf Epidemien und Krankheiten zu koordinieren.
Unter den nichtstaatlichen Geldgebern finden wir die weltgrößten Impfstoff- und Medikamentenhersteller, wie Gilead Sciences (eine Firma, die derzeit darauf drängt, dass eines ihrer Produkte für die Behandlung von Covid-19 zugelassen wird), GlaxoSmithKline, Hoffmann-La Roche, Sanofi Pasteur, Merck Sharp & Dohme, Chibret und Bayer. Die Pharmaunternehmen haben die WHO 2017 mit Dutzenden Millionen Dollar unterstützt. Dass private Impfbefürworter wie die Gates Foundation und Big Pharma die WHO so stark unterstützen, ist mehr als nur ein reiner Interessenkonflikt; es bedeutet im Grunde, dass sie die Ausrichtung der Organisation in ihrem Sinne beeinflusst haben, denn eigentlich ist die WHO dafür zuständig, die weltweiten Reaktionen auf Epidemien und Krankheiten zu koordinieren.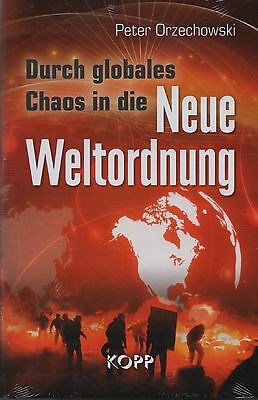 Unter Tedros hat sich die Lage, was Korruption und Interessenkonflikte bei der WHO betrifft, keineswegs verbessert, eher noch verschlimmert. Das WHO Health Emergencies Program, also die Abteilung, die für die globale Antwort auf Covid-19 zuständig ist, war einem Bericht der Australian Broadcasting Corporation (ABC) zufolge 2018 und 2019 unter Tedros‘ Ägide in einem miserablen Zustand, weil es nicht gelungen sei, das Programm und die Notfallabteilung mit ausreichenden Finanzmitteln zu versehen. Dadurch laufe man Gefahr, auf Länderebene nicht zu adäquaten Ergebnissen zu gelangen. Weiter heißt es in dem ABC-Bericht, die internen Korruptionsvorwürfe hätten innerhalb der gesamten Organisation deutlich zugenommen:
Unter Tedros hat sich die Lage, was Korruption und Interessenkonflikte bei der WHO betrifft, keineswegs verbessert, eher noch verschlimmert. Das WHO Health Emergencies Program, also die Abteilung, die für die globale Antwort auf Covid-19 zuständig ist, war einem Bericht der Australian Broadcasting Corporation (ABC) zufolge 2018 und 2019 unter Tedros‘ Ägide in einem miserablen Zustand, weil es nicht gelungen sei, das Programm und die Notfallabteilung mit ausreichenden Finanzmitteln zu versehen. Dadurch laufe man Gefahr, auf Länderebene nicht zu adäquaten Ergebnissen zu gelangen. Weiter heißt es in dem ABC-Bericht, die internen Korruptionsvorwürfe hätten innerhalb der gesamten Organisation deutlich zugenommen: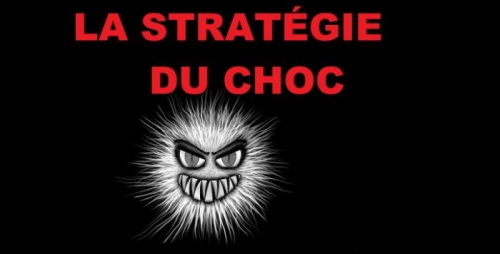



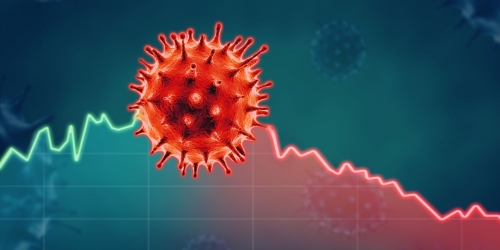





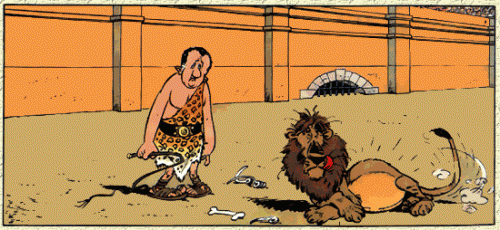

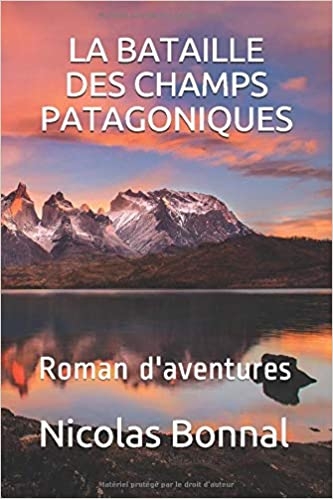 On aura donc les grandes entités totalitaires et staliniennes (Chine, Russie, qui fascinent encore quelques distraits…) et les dystopies féodales. L’Europe sort renforcée dit-on ; mais surtout affaiblie de cette histoire, donc je pense qu’on ira vers des micro-dictatures, comme je l’ai montré dans mon roman
On aura donc les grandes entités totalitaires et staliniennes (Chine, Russie, qui fascinent encore quelques distraits…) et les dystopies féodales. L’Europe sort renforcée dit-on ; mais surtout affaiblie de cette histoire, donc je pense qu’on ira vers des micro-dictatures, comme je l’ai montré dans mon roman 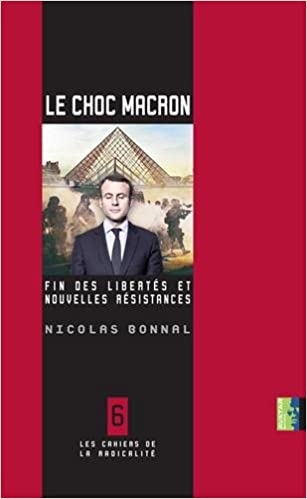 Puis je publie un roman d’anticipation, les territoires protocolaires, assez lu au Québec, et Internet nouvelle voie initiatique sur les origines cabalistiques du web et l’avènement du techno-gnosticisme qui va faire la chasse aux corps et créer un monde de néo-serfs et de techno-lords. Nous y sommes. Le livre est traduit en brésilien et inspire des thèses de doctorat. Il fit même la une du monde des livres ! Ensuite, pour résumer, je vis cinq ans hors des sentiers battus à Grenade puis en Amérique du Sud, ou la mondialisation me rattrape (« dans un monde unifié on ne peut s’exiler », dit Debord), et j’écris la
Puis je publie un roman d’anticipation, les territoires protocolaires, assez lu au Québec, et Internet nouvelle voie initiatique sur les origines cabalistiques du web et l’avènement du techno-gnosticisme qui va faire la chasse aux corps et créer un monde de néo-serfs et de techno-lords. Nous y sommes. Le livre est traduit en brésilien et inspire des thèses de doctorat. Il fit même la une du monde des livres ! Ensuite, pour résumer, je vis cinq ans hors des sentiers battus à Grenade puis en Amérique du Sud, ou la mondialisation me rattrape (« dans un monde unifié on ne peut s’exiler », dit Debord), et j’écris la 

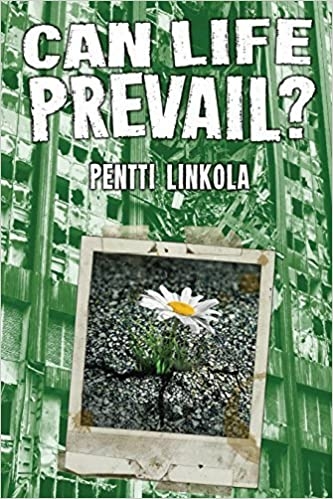 Pentti Linkola réclame la désindustrialisation globale ainsi que la sortie du capitalisme et de la société de consommation. Il exige par ailleurs l’arrêt de toute immigration, l’euthanasie pour les déficients et la fin des aides financières à un Tiers Monde en croissance démographique exponentielle. Il récuse enfin cette idée folle et meurtrière qu’est l’égalité. « Comment peut-on penser si stupidement que la vie humaine a la même valeur et la même humanité, la même moralité, indépendamment du nombre ? Il me semble clair que chaque fois qu’un nouvel enfant naît, la valeur de chaque humain dans le monde diminue légèrement. Il me semble évident que la moralité de l’explosion de population est complètement différente de celle de l’époque où l’homme était une espèce clairsemée et noble à ses débuts. » Son point de vue se rapproche de la vision de Julius Evola, lui aussi fort critique envers la politique nataliste du Ventennio fasciste. Dans son dernier entretien du 4 février 2020 avec Erkki Kiviemi pour le site Kulttuuritoimitus, il estime que « le coronavirus peut ralentir légèrement la destruction de la terre, mais une fois vaincu, le même mode de vie continuera. Tant que le progrès économique et le développement sont des objectifs humains clés, sauver la planète est perdue ».
Pentti Linkola réclame la désindustrialisation globale ainsi que la sortie du capitalisme et de la société de consommation. Il exige par ailleurs l’arrêt de toute immigration, l’euthanasie pour les déficients et la fin des aides financières à un Tiers Monde en croissance démographique exponentielle. Il récuse enfin cette idée folle et meurtrière qu’est l’égalité. « Comment peut-on penser si stupidement que la vie humaine a la même valeur et la même humanité, la même moralité, indépendamment du nombre ? Il me semble clair que chaque fois qu’un nouvel enfant naît, la valeur de chaque humain dans le monde diminue légèrement. Il me semble évident que la moralité de l’explosion de population est complètement différente de celle de l’époque où l’homme était une espèce clairsemée et noble à ses débuts. » Son point de vue se rapproche de la vision de Julius Evola, lui aussi fort critique envers la politique nataliste du Ventennio fasciste. Dans son dernier entretien du 4 février 2020 avec Erkki Kiviemi pour le site Kulttuuritoimitus, il estime que « le coronavirus peut ralentir légèrement la destruction de la terre, mais une fois vaincu, le même mode de vie continuera. Tant que le progrès économique et le développement sont des objectifs humains clés, sauver la planète est perdue ».


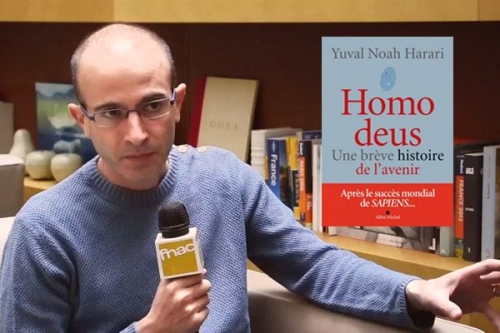

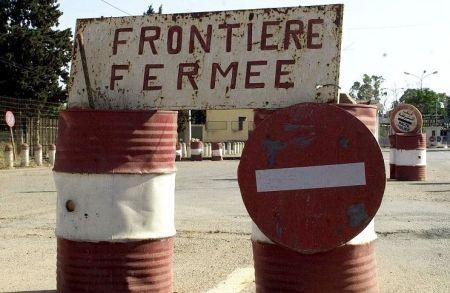
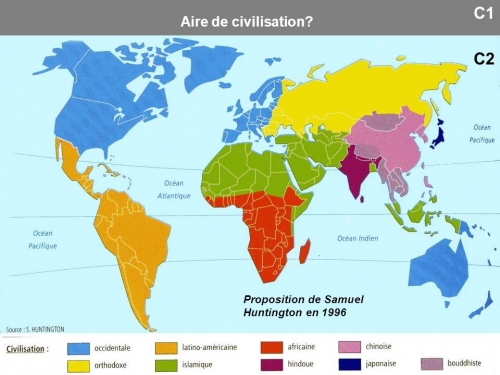

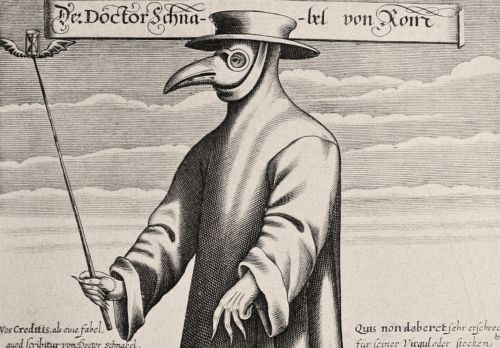

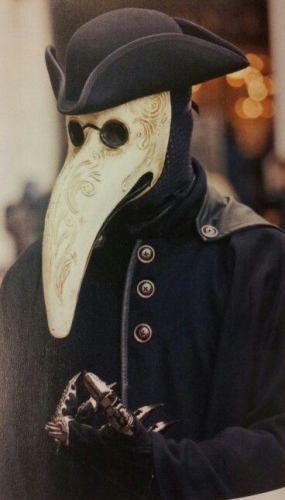 Comment le monde finit
Comment le monde finit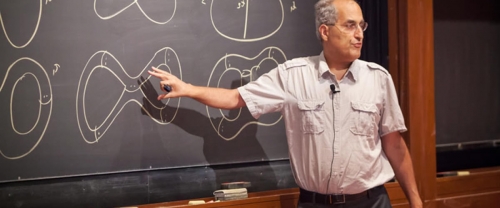

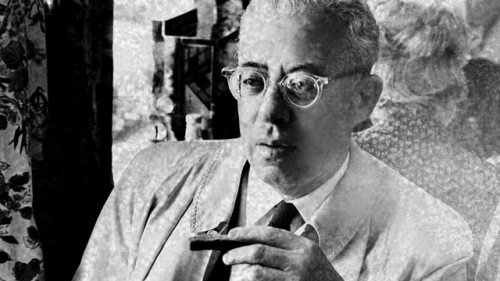
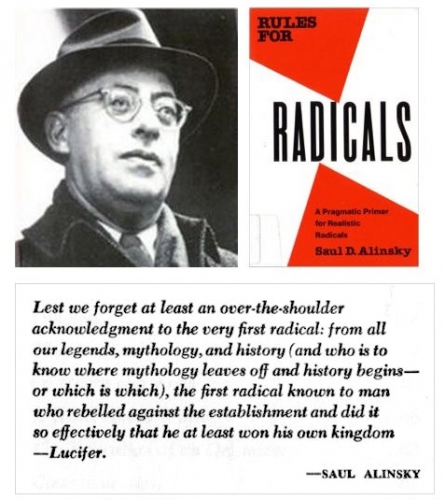
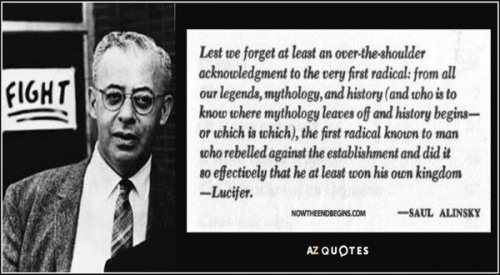
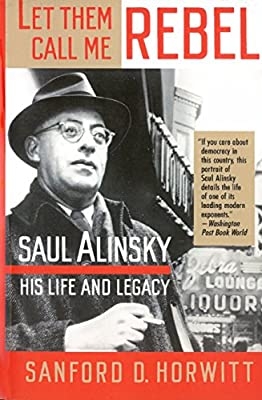 1) Le pouvoir. Alinsky est loin d’épouser une vision irénique de la démocratie. Le principe primordial de l’organizer est celui du pouvoir. Le pouvoir, soutient-il, est « l’essence même, la dynamo de la vie » (dans certains textes, il ira jusqu’à citer Nietzsche)
1) Le pouvoir. Alinsky est loin d’épouser une vision irénique de la démocratie. Le principe primordial de l’organizer est celui du pouvoir. Le pouvoir, soutient-il, est « l’essence même, la dynamo de la vie » (dans certains textes, il ira jusqu’à citer Nietzsche)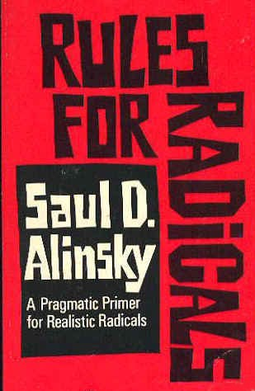 Surtout, Alinsky reconnaissait que les valeurs dénoncées par cette jeunesse en colère étaient justement celles auxquelles les pauvres pour lesquels il a milité aspiraient : en 1967, il remarquera : « Les gosses du SDS me disent : ‘Alinsky, tu sais ce que tu fais ? Tu organises les pauvres au nom de valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises, et matérialistes.’ Et je me trouve en train de répondre : ‘Vous savez ce qu’ils veulent, les pauvres, dans ce pays ? Ils veulent une part plus grande dans ces valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises ».
Surtout, Alinsky reconnaissait que les valeurs dénoncées par cette jeunesse en colère étaient justement celles auxquelles les pauvres pour lesquels il a milité aspiraient : en 1967, il remarquera : « Les gosses du SDS me disent : ‘Alinsky, tu sais ce que tu fais ? Tu organises les pauvres au nom de valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises, et matérialistes.’ Et je me trouve en train de répondre : ‘Vous savez ce qu’ils veulent, les pauvres, dans ce pays ? Ils veulent une part plus grande dans ces valeurs décadentes, ruinées, bourgeoises ».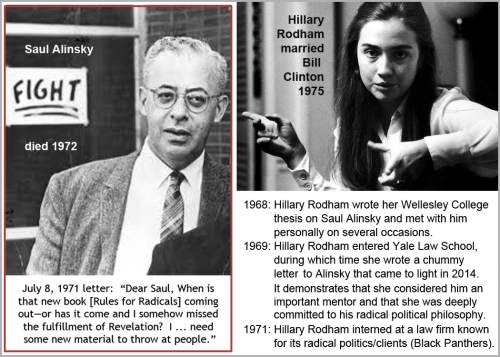
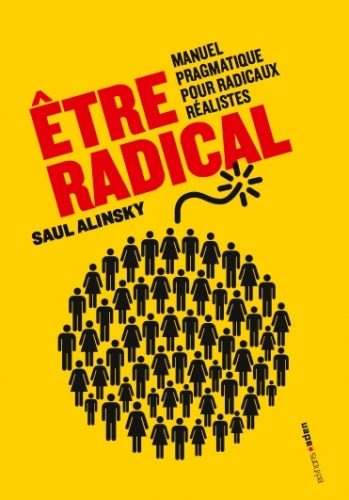 Situé au croisement de la tradition du « self-made man » et d’une sorte d’autogestion à l’américaine, Alinsky insiste toujours sur la nécessité des pauvres de pourvoir à leurs intérêts, mêmes « bourgeois » et « décadents », et nourrit un profond mépris pour les « libéraux » (au sens américain du terme, donc la gauche) qui, en prétendant connaître les intérêts profonds des couches sociales démunies, ne font que les infantiliser. Mais de là à rejoindre les critiques libérales (au sens européen) de l’Etat-providence ? Rappelons qu’en 1996, le président Clinton, appuyé par les Républicains, adopta la loi sur la « responsabilité personnelle » (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, PRWORA), qui supprima de nombreuses allocations destinées aux plus démunis (en particulier celles destinées aux enfants), en les remplaçant, au niveau des Etats fédérés, par une politique dite de « workfare », qui lie le droit aux prestations sociales à l’obligation de travailler (même dans des conditions indignes). Clinton annonça à cette occasion que « l’ère du big government » est terminé aux Etats-Unis. En dépit de son engagement profond pour les pauvres, Alinsky et sa méthode ne constituent-ils pas, par le biais de leur critique des aides gouvernementales au nom du savoir-faire spontané de la communauté, la voie détournée vers le « workfare » ?
Situé au croisement de la tradition du « self-made man » et d’une sorte d’autogestion à l’américaine, Alinsky insiste toujours sur la nécessité des pauvres de pourvoir à leurs intérêts, mêmes « bourgeois » et « décadents », et nourrit un profond mépris pour les « libéraux » (au sens américain du terme, donc la gauche) qui, en prétendant connaître les intérêts profonds des couches sociales démunies, ne font que les infantiliser. Mais de là à rejoindre les critiques libérales (au sens européen) de l’Etat-providence ? Rappelons qu’en 1996, le président Clinton, appuyé par les Républicains, adopta la loi sur la « responsabilité personnelle » (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, PRWORA), qui supprima de nombreuses allocations destinées aux plus démunis (en particulier celles destinées aux enfants), en les remplaçant, au niveau des Etats fédérés, par une politique dite de « workfare », qui lie le droit aux prestations sociales à l’obligation de travailler (même dans des conditions indignes). Clinton annonça à cette occasion que « l’ère du big government » est terminé aux Etats-Unis. En dépit de son engagement profond pour les pauvres, Alinsky et sa méthode ne constituent-ils pas, par le biais de leur critique des aides gouvernementales au nom du savoir-faire spontané de la communauté, la voie détournée vers le « workfare » ?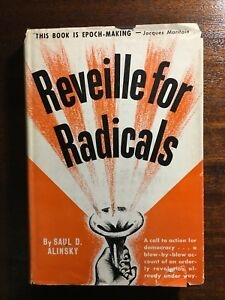 Mais Obama évoque le pouvoir de séduction qu’exerça sur lui le langage alinskien au cours de sa formation comme organizer : « L’action, le pouvoir, l’intérêt particulier. J’aimais ces concepts. Ils témoignaient d’un certain réalisme, d’un refus temporel pour le sentiment ; la politique, et non la religion ».
Mais Obama évoque le pouvoir de séduction qu’exerça sur lui le langage alinskien au cours de sa formation comme organizer : « L’action, le pouvoir, l’intérêt particulier. J’aimais ces concepts. Ils témoignaient d’un certain réalisme, d’un refus temporel pour le sentiment ; la politique, et non la religion ».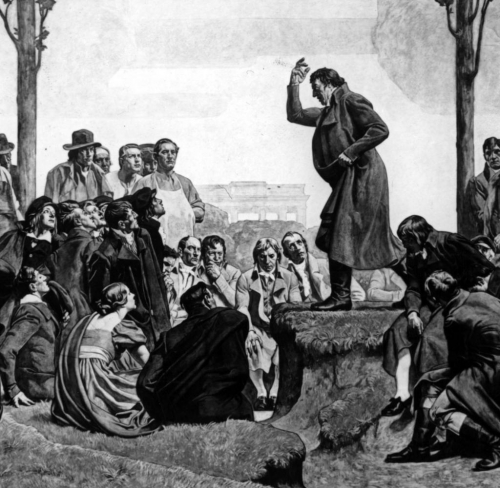
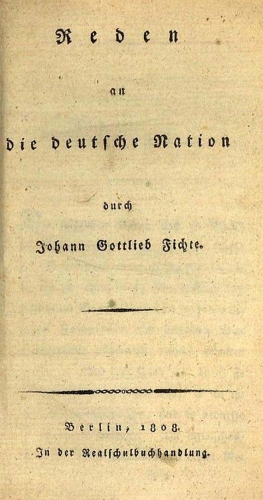 aduction française parue en 1992 à l’Imprimerie Nationale à Paris(1) et réalisée par le philosophe français, né en 1948, Alain Renaut, ce dernier se pose la question de la conception de la nation mise en avant par Fichte : celle née de la Révolution française, qui considère que le Tiers état la constitue, ou celle du romantisme allemand, « dont on a parfois soutenu qu’elle avait émergé avec la notion herderienne(2) de Volksgeist »,(3) qui veut que seuls les descendants de membres de la nation appartiennent à cette dernière ?
aduction française parue en 1992 à l’Imprimerie Nationale à Paris(1) et réalisée par le philosophe français, né en 1948, Alain Renaut, ce dernier se pose la question de la conception de la nation mise en avant par Fichte : celle née de la Révolution française, qui considère que le Tiers état la constitue, ou celle du romantisme allemand, « dont on a parfois soutenu qu’elle avait émergé avec la notion herderienne(2) de Volksgeist »,(3) qui veut que seuls les descendants de membres de la nation appartiennent à cette dernière ? « Si la nationalité procède d’un acte d’adhésion volontaire, l’accès à cette nationalité relève d’un libre choix : dans la logique révolutionnaire, il suffit de déclarer son adhésion aux droits de l’homme et, à partir de 1791, à la Constitution, pour devenir français.(6)
« Si la nationalité procède d’un acte d’adhésion volontaire, l’accès à cette nationalité relève d’un libre choix : dans la logique révolutionnaire, il suffit de déclarer son adhésion aux droits de l’homme et, à partir de 1791, à la Constitution, pour devenir français.(6) L’idée fichtéenne de nation
L’idée fichtéenne de nation



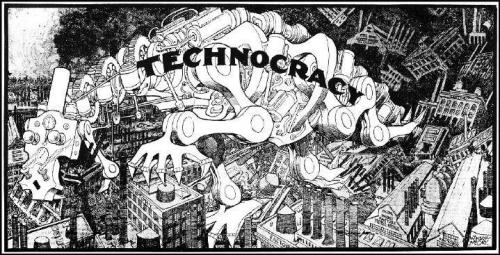

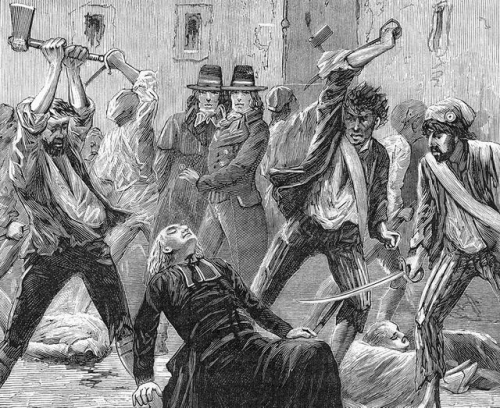
 "Dès son adolescence, écrit-il sans retenue, Robespierre fut probe modeste et studieux ; il prit de bonne heure la défense du faible contre le fort, de la raison contre le préjugé ; il arrive aux États Généraux, en 1789, plein de vénération pour la mémoire de Rousseau, dont il médita les écrits toute sa vie ; déjà il aimait et plaignait le peuple, abhorrait les grands méprisait les faiseurs d'esprit et était convaincu que tout était à reformer dans l'ordre civil et politique de la France."
"Dès son adolescence, écrit-il sans retenue, Robespierre fut probe modeste et studieux ; il prit de bonne heure la défense du faible contre le fort, de la raison contre le préjugé ; il arrive aux États Généraux, en 1789, plein de vénération pour la mémoire de Rousseau, dont il médita les écrits toute sa vie ; déjà il aimait et plaignait le peuple, abhorrait les grands méprisait les faiseurs d'esprit et était convaincu que tout était à reformer dans l'ordre civil et politique de la France."